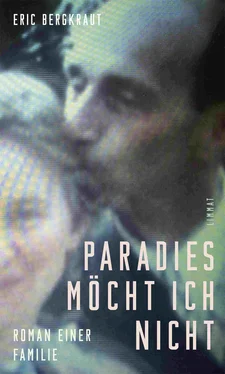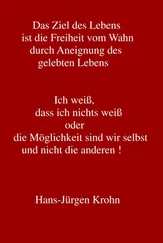Zuvor war Mutter immer wieder abgeprallt mit ihrem deutlichen Wunsch nach Austausch, nach Erfahrung. War sie die kleine Louise aus dem Chratz, war sie die Alte aus dem Heim, verloren war sie oft, verloren in der Zeit, verloren in der Welt. Zuletzt hatte sie aus ihrem Zimmer heraus durch die offene Tür so oft Hallohallo gerufen, dass es lästig geworden war. Man hatte beschlossen, ihre Rufe seien pathologisch und Mutter gehöre daher in den dritten Stock, wo ihre Rufe sich in den anderen verloren und vom Personal mit mehr Verständnis aufgenommen wurden.
Als ich mit Louise erstmals den Aufenthaltsraum betreten hatte, sagte sie: Es bedrückt mich, die sind alle meschugge, die Männer mehr noch als die Frauen, ich selber bin es auch, aber nur halb, lass uns ins Zimmer gehen.
Auf dem Weg hatte sich mir eine Clara vorgestellt und meine Hand geküsst wie auch jene von Juliette, die dabei war, und vorgeschlagen, später mit uns mitzukommen. Meine Tochter besuchte Louise gerne, auch ohne mich, die beiden konnten Stunden zusammen verbringen, der Großmutter gefiel, dass ihre Enkelin sich in die Bewegung zur Verteidigung der Umwelt eingereiht hatte. Sie war stolz darauf, dass Juliette immer wieder in den Klimastreik trat, obwohl die Schulleitung es ebenso verboten hatte wie irgendwann auch ich, ihr Vater. Amüsiert ließ sich Louise erzählen, wie die Lehrerin immer hilfloser nach einer passenden Strafe suchte.
Aus dem Gang schon hatte ich in Mutters Zimmer eine andere, füllige Frau entdeckt, die vorne am Fenster gemütlich am Brötchen kaute, das Juliette neben dem Halmabrett hatte liegen lassen. Sie und ich fanden das komisch, es war wie im Theater, Louise aber war durch die Frau verwirrt, ich bat sie aus dem Zimmer, täglich begleitete Mutter die Not, sie müsse den Ort wechseln, sie sei nirgends zu Hause.
Zur Welt gekommen war Louise fast einundneunzig Jahre vor diesem Halmaspiel in Albisrieden, heute ein Quartier von Zürich, damals ein Dorf. Im Chratz, dem Dorfteil gleich hinter der Kirche, bestehend aus lauter alten Fachwerkbauten, betrieb ihr Großvater das Restaurant Alperösli. Die Pöstler kehrten täglich zum Zvieri ein, Landjäger und Cervelat gab es, die Lehrer kamen zweimal jährlich zum Examensessen, ihnen wurde nobler Pot-au-feu serviert. Der Großvater, gelernter Schuhmacher, klein und untersetzt, mit Nickelbrille, war zugleich Friedensrichter, er sollte den Streit im Dorfe schlichten.
Während Großmutter Anna trotz insgesamt elf Kindern täglich für die Gäste kochte, stiegen zerstrittene Albisrieder über den Hintereingang in den ersten Stock. Dort war das enge Zimmer des Friedensmannes, der in seiner Doppelrolle eine Stütze der dörflichen Gesellschaft war, eine Respektsperson. Im «Alperösli» lernte Louises Mutter Lina ihren Mann kennen, Ernst, einen Turner aus Aarau, der mit seiner Riege nach einem Wettkampf auf ein Bier haltgemacht hatte.
Das Paar zeugte in schneller Folge vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen. Als meine Großmutter mit Louise schwanger war, der jüngsten, verließ Ernst seine Frau. Ein paar Wochen später musste sie die gemeinsame Wohnung im Aargau verlassen. Die Jungs durften beim Vater bleiben, eine neue Frau stand schon bereit, auch diese hatte er in einer Gaststätte kennengelernt, die Mädchen sollten mit der Mutter weg, egal wohin, einfach weg. Zwar schickte der Friedensrichter einen kleinen Lastwagen nach Aarau, aber Hab und Gut, seine Tochter und die beiden Enkelinnen waren im «Alperösli» nicht erwünscht. Eine Geschiedene war der Schmach zu viel, für sie war kein Platz im großen, heimeligen Haus des Friedensrichters.
Fünf Jahre lebte die verstoßene junge Frau auf dem Land, das Geld war knapp. Der Kindsvater schickte etwas Alimente, der Friedensrichter legte ein bisschen dazu und ließ sich endlich erweichen: Lina und ihre Töchter durften zurück. Glücklich zu Hause, trotz des Makels, verlassen worden zu sein, sprang Lina im Restaurant ein, wann immer es nötig war, und half rundum allen Menschen, wo immer sie konnte.
Nachbarskind Margrith machte jeden Morgen halt, wenn sie Louise zur Schule abholte; sie setzte nacheinander den rechten und dann den linken Fuß auf der Steintreppe ab, die zur kleinen Wohnung führte. Lina band ihr den Doppelknopf, den sie so gut konnte, und Louise freute sich, viel galt ihre geschiedene Mutter nicht in Albisrieden, in der Schule wurde sie ausgelacht.
«Margrithli», wie Lina sie immer nannte, kam nach der Schule oft mit in den Chratz, sie mochte meine Großmutter. Vom Wohnzimmer ging eine steile Treppe in den ersten Stock, ein Bälchli, oben schliefen Mutter und die jüngere Tochter in einem Zimmer. Hier erledigten die beiden Mädchen, die eine blond, die andere rot, ihre Schularbeiten. Die Familie war arm, mit dem Abendessen wartete Lina, bis Margrithli gegangen war, das Essen reichte nicht für ein weiteres Maul. Mag sein, dass Louises oft ausschweifende Gastfreundschaft hier ihren Ursprung hat; bis zur Aufdringlichkeit bot sie zu trinken an, Wein und anderes, sie liebte es, Zimmer mit so viel Betten auszustatten wie nur möglich, es konnte noch wer kommen.
Sie wuchs heran, ein waches Kind, das bald männliche Blicke auf sich zog. Coiffeur Huber, ein gebürtiger Basler, hatte seinen Salon gleich neben dem «Alperösli» des Großvaters, unter dem gleichen Dach. Vor dem ersten Haarschnitt – sie war neun oder zehn – zog er nicht nur Louise einen Umhang über, sondern auch sich selber. Er fasste mit der rechten Hand die Schere, griff mit der linken nach Louises Hand und führte sie unter die Kutte, wo sie etwas hart Fleischiges halten musste. So gehöre es sich bei ihm und zum Haarschnitt, erklärte er dem eingeschüchterten Mädchen. Was sie festzuhalten hatte, verstand sie lange nicht, niemand hatte mit ihr je über Derartiges gesprochen, sie lebte in einem Frauenhaushalt, und es gab keine auch nur ungefähre Anschauung. Es war ihr unangenehm, sehr, bei Huber, und mehr als das. Der Friseur keuchte, sein Atem schlug ihr stickig ins Gesicht, wenn er die Kopfseite wechselte, erneut nach ihrer Hand griff und sagte: Nicht loslassen.
Später bekniete Louise ihre Mutter, sie wünsche sich langes Haar. Es nützte nichts. Wenn man schon arm war, sollte man doch gepflegt daherkommen, meinte Lina. Ihrer Mutter zu erzählen, was sich im Salon abspielte, kam Louise nicht einmal in den Sinn. Sie begann eine kaufmännische Lehre, es ging weiter. Den Morgendienst eröffnete der Chef der Druckerei im Hinterzimmer, indem er Louise am ganzen Körper abtastete. Er hatte damit einfach angefangen und dann so getan, als sei es so abgemacht. Einmal, sie waren alleine im Betrieb, sollte sich die Fünfzehnjährige morgens nackt auf den Tisch legen, das war zu viel.
Niemand außer Margrith wusste, dass die Männer sich angewöhnt hatten, von Louise zu nehmen, was immer sie wollten. Und dass sie nicht wusste, wie sie sich wehren konnte. Louise begann, ihre Gedanken in ein schwarzes Heft zu schreiben, gekauft in der Papeterie Kaufmann beim Dorfplatz. Weder Lina noch ihre ältere Schwester sollten davon erfahren, Louise versteckte das Heft mal unter dem Holz, das im Vorraum zu den Toiletten gestapelt lag, mal unter ihren Kleidern im Schrank. Sie schrieb von Sünden, auch eigenen, und dass sie den nächsten Sonntag herbeisehne. Der liebe Gott war eine Instanz geworden, das Heft ihr Begleiter.
In Europa herrschte Krieg, zu Hause war es eng. Louise trat der kommunistischen Jugend bei, zugleich unterrichtete sie in der evangelischen Sonntagsschule. Hier waltete ein charismatischer Pfarrer, eine große Figur in Albisrieden, seine Kirche war nur einen Steinwurf vom Chratz entfernt. Er wurde die bewunderte Liebe, vielleicht auch der Vater, den sie sich gewünscht hätte. Ihm vertraute sie sich an, er fand eine neue Lehrstelle für sie. Die beiden spazierten auf den Uetliberg, den Haushügel von Zürich, sie sollte erzählen. Dann plötzlich zwang er sie zum Kuss. Mehr nicht?, fragte ich Louise irgendwann zwischen ihrem siebzigsten und achtzigsten Lebensjahr, als sie mir davon erzählte. Nein, sagte sie trocken, es war Winter, es lag Schnee.
Читать дальше