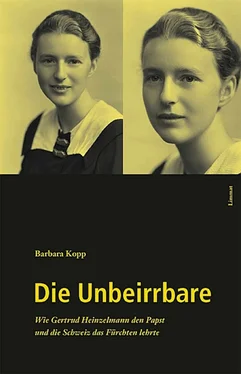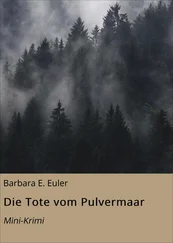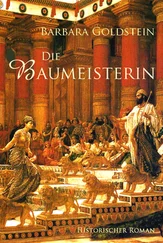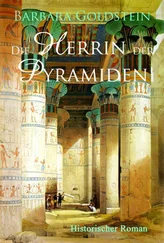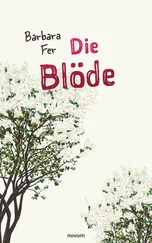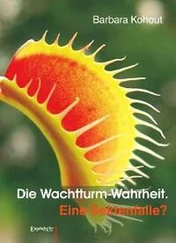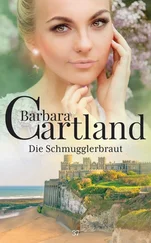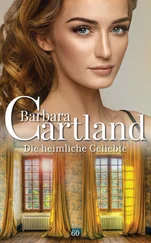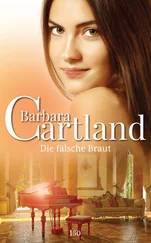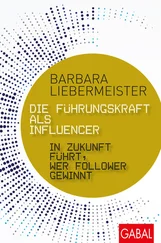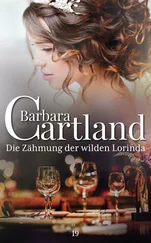An ihre Großmutter hat Gertrud Heinzelmann keine eigene Erinnerung. Am Arm der Mutter blickt sie als Dreijährige auf das Sterbebett der krebskranken Sophie Heinzelmann, geborene Rietschi. Der Vater wird ihren Nachlass bis auf zwei Fotografien und eine Postkarte aus Brüssel verbrennen, damit nichts an ihr Unglück und das ihrer Söhne erinnere. Eine der beiden Fotografien zeigt sie im mittleren Alter, mit demselben klaren und willensstarken Gesichtsausdruck wie ihre jüngere Schwester Salesia. Auch ihr Blick ist kein bürgerlicher, sondern einer, der von standesbewusster Höhe auf das Gegenüber hinab gerichtet ist. Im Gegensatz zu Salesia zeigen sich in Sophies Gesicht Härte, Resignation und verhaltener Spott.
Sophie Rietschi hatte Charles Maximilian Heinzelmann, einen Deutschen mit Genfer Bürgerrecht, geheiratet. Nach unglücklichen Ehejahren reichte sie als eine der ersten Schweizerinnen die zivile Scheidung ein. Für eine Frau im Jahr 1890 ein kühner Schritt, der mit gesellschaftlichem Abstieg und Ächtung verbunden war. Ihre Großmutter, so Gertrud Heinzelmann, habe es nicht hinnehmen wollen, von ihrem Mann geschlagen zu werden. Nach der Scheidung ließ sie ihre Kinder, Hans war drei und Karl ein Jahr alt, im Freiamt zurück, emigrierte nach Brüssel und arbeitete sich zur Gerantin der königlichen Confiserie hoch. Auf der Treppe zum Geschäft ließ sie sich mit Ladenmädchen und Kundinnen fotografieren und schickte das Bild als Postkarte ihrem ältesten Sohn nach Boswil. Hans wuchs bei Tante Salesia auf, die das Scheidungskind mit dem «Dröhtli» stärkte. Die finanziellen Mittel reichten gerade für eine kaufmännische Ausbildung, und in der königlichen Confiserie in Brüssel absolvierte er ein Praktikum, aber niemand durfte erfahren, dass die Gerantin seine Mutter war.
Karl hingegen traf das schlechtere Los des Zweitgeborenen. Er kommt in ein Kinderheim und ist seither sozial gezeichnet. Die Verwandtschaft bedauert ihn, denn er ist aus demselben Fleisch und Blut, doch gemessen an den familiären Wertvorstellungen schlägt er aus der Art. Er gehört nicht ganz dazu, weil er Liebesaffären hat, die nicht zu geordneten Verhältnissen führen, und weil er trotz Sprachbegabung als Kellner und Straßenwischer durchs Leben vagabundiert. «Er ist nicht ganz geraten, aber auch nicht gefehlt», 10so Bertha an Bruder Paul. Die familienbewusste Gertrud Heinzelmann besitzt von diesem «armen Tropf» ein einziges Foto, über sein Leben weiß sie fast nichts. Er stirbt im Zweiten Weltkrieg verarmt im Bürgerasyl von Genf.
Im Studium reagiert Gertrud Heinzelmann mit «heisskochender Empörung» 11auf die Benachteiligung der Frauen im damaligen Eherecht. Sie verehrt zeitlebens die Großmutter für ihr Selbstbewusstsein und ihren Unabhängigkeitswillen. In einer ihrer letzten Veröffentlichungen schreibt sie 1991: «Ich bewundere Sophie Rietschi ausserordentlich. Sie hatte den Mut, damals, als es kaum Existenzmöglichkeiten für Frauen gab, sich von ihrem Mann zu befreien und selber für ihre beiden Kinder das Geld zu verdienen.» 12Die Heinzelmanns hätten gerne wieder Rietschi geheißen, aber der verhasste Name ließ sich nicht mehr abstreifen.
Ebenso prägend wie das «Dröhtli» ist in Gertrud Heinzelmanns Jugend die katholische Kirche. Pompöse Kirchenfeste und fromme Volksbräuche prägen ihre Schulzeit. Das Doktorhaus steht in Boswil am Kirchweg, wo die Prozessionen vorüberziehen, und wenn die Großtante mit ihren Nichten Einkäufe tätigt, kommen sie auf ihrem Weg an Bildstöcken und Kruzifixen vorbei. Im Merceriegeschäft, das von zwei Schwestern geführt wird, begutachtet Salesia mit der einen Ladenbesitzerin das Angebot an Stricknadeln, während die andere den Mädchen das kostbarste und selbstverständlich unverkäufliche Stück zeigt: ein langer Metallnagel, der einst im blutigen Fleisch des Gekreuzigten gesteckt haben soll. In ihrem «kindlichen Gemüt», so Gertrud Heinzelmann, habe dieser Nagel einen «unauslöschbaren Eindruck» 13hinterlassen. In Wohlen besucht die Mutter mit ihren Töchtern die Messe, in der an hohen Feiertagen ein Schauspiel geboten wird. An Karsamstagen stehen in der Kirche Felskulissen mit einer Grabnische, und hinter Glaskugeln, die mit gefärbtem Wasser gefüllt sind, brennen Kerzen. Dank Theaterbühnentechnik verschwindet während der Messe Christus mit Getöse in der Grabnische und erscheint wieder von der Kirchendecke hängend als Auferstandener.
Im liberalen Milieu der Heinzelmannschen Familie ist der Umgang mit der Kirche, der Gertrud und Elisabeth vermittelt wird, widersprüchlich. Die Eltern verstehen sich als Katholiken und somit zur Kirche zugehörig, aber ins Private dreinreden lassen sie sich von keinem Geistlichen, am katholischen Vereinsleben nehmen sie nicht teil, von der Konservativen Volkspartei 14distanzieren sie sich, schließlich halten sie es mit den freisinnigen Unternehmern und Industriellen aus dem Wohler Bahnhofsquartier. Wie jeder Rietschi verweigert Hans Heinzelmann den Kirchenbesuch, Bertha hingegen geht wie manche Frau aus liberalen Verhältnissen dennoch zur Messe. Ihr Abseitsstehen demonstrieren die Eltern dem Dorf während der Prozession an Fronleichnam. Die Route führt am großelterlichen Wohnhaus vorbei, der Festumzug hält hier an, der Priester betet an einem eigens aufgestellten Altar, und ein Chor singt. Die Eltern und Großeltern mischen sich nicht unter die Schaulustigen, sondern schließen, für alle sichtbar, die Fensterläden und verschanzen sich im Haus. Trotz dieser Distanzierung setzen die Eltern ihre Tochter der Kirche aus und lassen sie mit ihren Gefühlen allein. Gertrud Heinzelmann beschreibt diese Erfahrung als Erwachsene so:
«Es gehört wohl zu meinen ältesten frühkindlichen Erinnerungen, dass ich am damaligen Wohnsitz meiner Grosseltern zusammen mit dem alten gelähmten Hauseigentümer an einem Fronleichnamstag in den Garten gesetzt wurde, in dem alljährlich ein Altar als Station der volksreichen Prozession aufgebaut war. Die Kunde vom ‹Heiland› (wer hatte mir davon erzählt?) hatte schon lange zuvor mein kindliches Sinnen beschäftigt. Dann – über dem Gartenweg Monstranz, Baldachin, Weihrauch, nie gesehene Gewänder. Allein mit dem gelähmten Greis sass ich in einem von Gebüsch umhegten Chor, einem Geschehen mit überwältigenden Eindrücken preisgegeben, von denen ich nur das Wort ‹Heiland› verstand. Aber diesen mit ungeheurer Gefühlsintensität Erwarteten sah ich nicht trotz aller Anstrengung, aus einer seelischen Spannung fiel ich hoffnungslos in eine nicht zu bewältigende Enttäuschung. Schliesslich löste ein Strom von Tränen Überwältigung und Anspannung. Meine Mutter kam, trug mich in das Haus zurück, in dem die Erwachsenen sich hinter geschlossenen Fensterläden versammelt hatten.» 15
Als die Tochter älter ist und ihre Schulklasse an der Fronleichnamsprozession teilnehmen muss, stellt sich der Vater auf die Treppe vor dem großelterlichen Haus, pfeift und ruft seine «Trut» energisch aus der vorbeimarschierenden Menge ins Haus.
Ambivalent muss auch Salesia Rietschis Verhältnis zum Katholizismus gewesen sein. Nach Gutdünken vermittelt die Großtante ihren Nichten frommes Brauchtum, erfindet vor dem Einschlafen lange Gebete, die mehr Gute-Nacht-Geschichten sind. Das Tischgebet spricht sie, während sie der Magd Babeli Christen in der Küche beim Anrichten hilft, mit Schüsseln zum Esstisch kommt und wieder hinaus geht. Für die Kinder, die auf ihren Stühlen warten, ist Folgendes zu hören: «Gib uns unser täglich Brot … Babeli, tüend d’Suppe arichte … Du bist voll der Gnaden … und de no de Schnittlauch dri.» 16Sie liest «Das Vaterland», die federführende Zeitung der Katholisch-Konservativen, doch in Boswil teilt sie jedem, der es wissen will, unmissverständlich mit, dass sie, wie alle Rietschis, eine Freisinnige sei, ergo nichts mit den Rückständigen am Hut habe. Das hört man im Dorf vermutlich nicht allzu gerne, hier dominiert die Konservative Volkspartei, und der H.H. Pfarrer, wie die Dorfchronik «Hochwürden» nennt, ist so einflussreich wie der Gemeindeammann oder der Gemeindeschreiber. Salesia lässt sich in keinem katholischen Dorfverein blicken, weder in der «Marianischen Kongregation» noch im «Katholischen Frauen- und Töchterverein». Sie entzieht sich den Organisationen, die nach verlorenem Kulturkampf von den Katholisch-Konservativen zur Abwehr freisinnigen und liberalen Gedankenguts überall gegründet wurden. Damit nimmt sich die Gemeindelehrerin weltanschaulich Freiheiten heraus, aber nur so weit, als ihr gesellschaftliches Abseitsstehen vom Dorf geduldet wird. Sonntags besucht sie die Messe.
Читать дальше