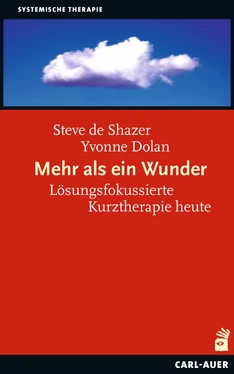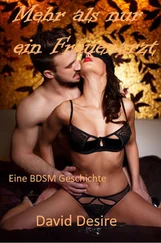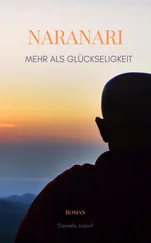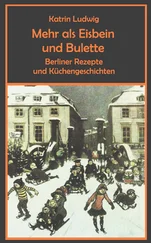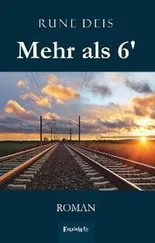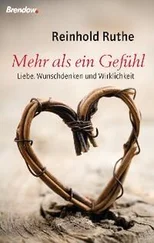Zweitens: Der Klient antwortet, dass die Situation sich zu bessern beginne oder besser geworden sei. In diesem Fall stellt der Therapeut viele Fragen zu den Veränderungen, die sich abzuzeichnen beginnen, was die Erhebung vieler Einzelheiten erfordert. Damit beginnt der Prozess des »Sprechens über Lösungen«, in dem von Anfang an die Stärken und Resilienzen des Klienten betont werden und der es dem Therapeuten erlaubt, die Frage zu stellen: »Angenommen, diese Veränderungen würden weiterhin in diese Richtung gehen; wäre es dann das, was Sie gerne hätten?« Diese Frage bietet die Möglichkeit, ein konkretes, bejahendes und an Veränderung orientiertes Ziel ins Auge zu fassen.
Drittens: Der Klient teilt mit, dass die Situation gleich geblieben sei. In diesem Fall kann der Therapeut z. B. fragen: »Ist es ungewöhnlich, dass die Situation nicht schlimmer geworden ist?« oder »Wie haben Sie überhaupt verhindern können, dass die Situation nicht schlimmer geworden ist?«. Solche Fragen können Informationen über frühere Lösungen und Ausnahmen aufdecken und diese zum Thema eines lösungsfokussierten Gesprächs werden lassen.
Auf Lösungen gerichtete Ziele . Wie in vielen psychotherapeutischen Modellen sind klare, konkrete und spezifische Ziele auch im Konzept der lösungsfokussierten Kurztherapie ein wichtiges Element. Der lösungsfokussiert arbeitende Therapeut strebt an, dass sich möglichst eher kleinere als größere Ziele herauskristallisieren. Noch wichtiger ist es, Klienten dazu zu ermuntern, ihre Ziele als Lösung zu definieren und nicht als die Abwesenheit eines Problems. Es ist z. B. vorteilhafter, wenn ein Ziel so formuliert wird: »Wir wollen, dass unser Sohn netter zu uns ist« – was ausführlicher beschrieben werden müsste – und nicht so: »Wir hätten es gerne, dass unser Kind uns nicht zum Teufel wünscht«. Außerdem: Wenn ein Ziel als Lösung formuliert wird, lässt es sich leichter skalieren (siehe unten).
Die Wunderfrage . Manchen Klienten fällt es schwer, überhaupt ein Ziel zu formulieren – von einem lösungsfokussierten Ziel ganz zu schweigen. Das gilt vor allem für Multiproblem-Familien oder solche Menschen, denen das Problem so massiv vorkommt, dass sie allein schon aufgrund der Beschreibung eines Ziels den Eindruck bekommen, dadurch würde das Ausmaß des Problems und seine erdrückende Wirkung auf die Betroffenen abnehmen. Wenn man die Wunderfrage einsetzt, um nach einem Ziel des Klienten zu fragen, vermittelt dies einerseits einen gewissen Respekt vor der Größe des Problems, führt aber gleichzeitig auch dazu, dass der Klient sich kleinere und besser zu bewältigende Ziele ausdenkt.
Der genaue Wortlaut dieser Intervention kann zwar schwanken, aber die Grundformulierung ist folgende:
Ich stelle Ihnen jetzt eine ziemlich seltsame Frage. [Pause] Die seltsame Frage lautet: [Pause] Nach unserem Gespräch werden Sie zurück zu Ihrer Arbeit (nach Hause, in die Schule) gehen, und Sie werden den restlichen Tag damit verbringen, ihren Alltagsgeschäften nachzugehen, z. B. die Kinder versorgen, Abendessen zubereiten, fernsehen, die Kinder baden usw. Schließlich wird es Zeit sein, schlafen zu gehen. Um Sie herum ist es ganz still, und Sie schlafen friedlich ein. Mitten in der Nacht geschieht ein Wunder, und das Problem, über das Sie heute mit mir sprechen, ist gelöst! Doch dies geschieht, während Sie schlafen, und deshalb können Sie gar nicht wissen, dass in der Nacht ein Wunder geschehen ist, das Ihr Problem gelöst hat. [Pause] Worin könnte, wenn Sie dann morgen früh aufwachen, die kleine Veränderung bestehen, sodass Sie sagen werden: »Toll, es muss etwas passiert sein – das Problem ist weg!« (Berg a. Dolan 2001, p. 7)?
Auf die Wunderfrage reagieren Klienten ganz unterschiedlich. Manche sind verwundert und sagen vielleicht, dass sie die Frage nicht verständen. Manche lächeln auch. Wenn Klienten genügend Zeit zum Nachdenken haben, fallen Ihnen jedoch meistens einige sehr spezifische Dinge ein, die anders wären, wenn ihr Problem gelöst wäre. Diese Antworten kann man dann üblicherweise als Therapieziele annehmen. Insofern führen die Reaktionen des Klienten zu einer mehr ins Detail gehenden Beschreibung davon, wie er sich sein Leben vorstellt, was dann wieder dazu beitragen kann, dass er seine früheren Lösungen und Ausnahmen beleuchtet.
In Paar-, Familien- oder Gruppentherapien kann man die Wunderfrage den einzelnen Personen stellen oder sie an die gesamte Gruppe richten. Wenn man individuell fragt, antwortet jede einzelne Person auf die Frage, und möglicherweise reagieren die anderen Anwesenden auf die Antworten der Einzelnen. Der Therapeut könnte die anderen ermutigen, die individuell vorgetragenen Wunderbeschreibungen zu unterstützen. Wenn die Wunderfrage an das Paar, die Familie oder eine Gruppe gerichtet wird, können die Anwesenden gemeinsam ihr Wunder »erarbeiten«. Dadurch, dass der lösungsfokussiert arbeitende Therapeut versucht, unter den Teilnehmern eine kooperative Haltung zu bewahren, betont er die Ähnlichkeit ihrer Ziele und das unterstützende Moment ihrer Aussagen (weitere Einzelheiten zur »Wunderfrage« und ihrer Verwendung siehe nachfolgende Kapitel).
Skalierungsfragen . Unabhängig davon, ob der Klient ohne Umwege oder aber über die Wunderfrage auf spezifische Ziele kommt, ist die nächste Intervention wichtig: dass nämlich die einzelnen Ziele skaliert werden. Der Therapeut fragt den Klienten nach der Skala zur Wunderfrage: »Auf einer Skala von 0 bis 10 (bzw. von 1 bis 10), wo standen die Dinge, als die Stunde vereinbart wurde, wo stehen sie jetzt, und wo werden sie am Tag nach dem Wunder sein?« Dazu das Fallbeispiel eines Paares, dessen Ziel bessere Kommunikation ist:
THERAPEUT: Als Nächstes möchte ich das Problem und das Ziel auf einer Skala einstufen. Nehmen wir an, eine 1 bedeutet, dass das Problem so schlimm ist, wie es nur sein kann, dass Sie überhaupt nicht miteinander reden, sich nur streiten oder sich die ganze Zeit über aus dem Weg gehen. Und nehmen wir an, eine 10 bedeutet, dass Sie die ganze Zeit über miteinander reden, sich perfekt verständigen können und sich überhaupt nicht streiten.
EHEMANN: Das ist ziemlich unrealistisch.
THERAPEUT: Das wäre der Idealzustand. Also, wo würden Sie beide die Situation einordnen, als sie am schlimmsten war, also vielleicht zu der Zeit, kurz bevor Sie zu mir kamen?
EHEFRAU: Es war ziemlich schlimm … ich weiß nicht, … ich würde sagen, bei der 2 oder 3.
EHEMANN: Ja, ich würde sagen, bei der 2.
THERAPEUT: Okay [schreibt] … eine 2 bis 3 für Sie – und eine 2 für Sie. Nun wüsste ich noch gerne, womit Sie zufrieden wären, wenn die Therapie vorbei und erfolgreich ist.
EHEFRAU: Ich wäre mit einer 8 zufrieden.
EHEMANN: Also, ich hätte natürlich gerne eine 10, aber das ist unrealistisch. Ja, ich gebe zu, eine 8 wäre gut.
THERAPEUT: Wo würden Sie die Situation jetzt im Moment einordnen?
EHEFRAU: Ich würde sagen, sie ist ein bisschen besser, weil er mit mir hierher gekommen ist, und ich sehe, dass er versucht … ich würde sagen, vielleicht bei der 4?
EHEMANN: Also, das höre ich gern. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die Situation so weit oben einordnet. Ich würde sie bei der 5 einordnen.
THERAPEUT: Okay, eine 4 für Sie – und eine 5 für Sie. Und Sie beide wollen, dass Sie die Situation bei der 8 haben, damit Sie sagen können, die Therapie war erfolgreich, richtig?
Diese Intervention hat zwei wesentliche Komponenten. Zum einen ist sie ein Instrument zur Beurteilung von Lösungen, d. h., wenn sie in jeder Therapiesitzung durchgeführt wird, können Therapeut und Klienten damit kontinuierlich ihren Fortschritt messen. Zum anderen ist sie per se ein wirkungsvoller Eingriff, weil sie dem Therapeuten erlaubt, auf frühere Lösungen und auf Ausnahmen zu fokussieren und auf Veränderungen während ihres Entstehens aufmerksam zu machen. Genauso, wie sich Dinge vielleicht schon vor dem ersten Therapiegespräch verändert haben, kann sich die Situation des Klienten auch zwischen den einzelnen Sitzungen in drei Richtungen entwickeln: (1) Die Situation kann besser werden; (2) die Situation kann unverändert bleiben; (3) die Situation kann sich verschlechtern.
Читать дальше