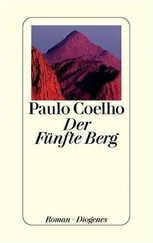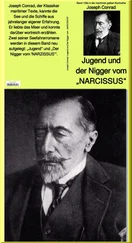Ganz früher hatten wir wenig Kontakt zu den anderen im Dorf. Wir waren ja selbst eine grosse Familie. Jede Familie war für sich. Als Kind lernte ich: Du darfst nichts erzählen. Was in der Familie passiert, das geht die anderen nichts an. Jeder musste für sich schauen, sonst ging man unter. Wenn das Misère [Unglück] da ist, dann schaut jeder zuerst für sich. Das ist normal. Und wenn alle genug haben, dann kannst du teilen. Verstehst du? Das kannst du nicht anders machen. Du schaust für dich, du musst, sonst überlebst du nicht.
Mit den Verwandten hatten wir Kontakt. Die Buben arbeiteten manchmal für Onkel Theodul, den Bruder meiner Mutter. Tante Serafine, die Schwester meiner Mutter, sahen wir oft. Wir halfen einander. Sie half uns beim Rebenbinden und wir gingen ihr Heuen. Wir gingen auch oft zu Tante Serafine und tauschten uns mit ihr aus. Ich weinte mich auch hin und wieder bei ihr aus, wenn ich grossen Kummer hatte. Oder ich ging zu meiner Lieblingskuh, dem Hasu, einer weissen Kuh mit geraden Hörnern. Schon als kleines Mädchen durfte ich den Hasu führen, wenn wir mit dem Vater aufs Feld gingen. Die Kuh war immer da, wenn wir sie brauchten. Sie gehörte zur Familie, sie teilte Freud und Leid mit uns. Nach getaner Feldarbeit hirtete ich sie. Ich war dadurch oft mit ihr alleine, was ich sehr schätzte. Einmal gingen Mary und ich sie hüten und sagten zueinander, dass wir doch auch auf ihr reiten könnten. Gesagt, getan. Ich führte die Kuh gegen eine Mauer, Mary stieg auf und wir liefen gemeinsam ein Stück. Da bekam ich Angst und sagte zu ihr, sie solle heruntersteigen. Als wir abends nach Hause zurückkehrten, gab es ein Donnerwetter. Jemand hatte uns beobachtet und es dem Vater erzählt. Man könne auf einer Kuh nicht reiten, dafür seien die Pferde da, so sagte er. Um Heu von der Scheune in den Pflanowinien nach Varen zu transportieren, musste man entweder das Heu selbst tragen oder ein Pferd mieten. Aufgrund unseres Experiments kam der Vater jedoch auf die Idee, dass die Kuh, wenn sie ein Kind tragen könne, auch Heu müsse tragen können. So versuchte er es, und in der Tat trug der Hasu das Heu hoch nach Varen. Das kam sehr gelegen, denn es war Krieg und die Pferde waren für das Militär eingezogen worden. Später schleppte der Hasu sogar Baumaterialien und Zementsäcke von Birchen hoch in die Weid, als der Vater dort umbaute, um die Küche mit dem Zimmer zu verbinden. Als der Hasu alt war, ging der Vater mit ihm nach Leuk auf den Markt. Mir tat das Herz weh und ich hoffte, er könne ihn nicht verkaufen. Vater kam jedoch alleine zurück und ich war todunglücklich.
Später arbeitete ich bei Tante Anna, einer weiteren Schwester meiner Mutter, kurz vor ihrem Tod. Als ihre drei Kinder noch ganz klein waren, starb Anna an Magenkrebs. Während der Krankheit half ich ihr und machte die Haushaltung. Auch bei Kriegsende war ich noch bei ihr. Überall läuteten die Glocken. Das weiss ich noch gut, alle freuten sich, jetzt ist Frieden, der Krieg ist fertig. Als Anna dann starb, kehrte ich wieder nach Hause zurück. Ich sah Annas Mann Pius viel später einmal, da konnte er schon fast nicht mehr laufen. «Du hast mir doch dazumal geholfen», meinte er, «als ds’Anny krank war. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil ich dich zu wenig entlohnt habe.» Ich erwiderte: «Das ist apa [wahrscheinlich] schon richtig gewesen.» Aber es stimmt schon, er gab mir nichts. Und ich erinnere mich, dass auch der Vater sagte, das sei eigentlich schon haarig, da gebe man das Mädchen und erhalte nicht einmal ein Merci. Mir war das egal, ich brauchte ja auch nichts. Man muss aber schon sagen, im Dorf hatte niemand Geld, ausser denjenigen, die in der Alusuisse in Chippis arbeiteten. Das Leben hat sich so geändert seither. Die Leute früher haben alle so gelebt, während Jahrhunderten. Alle Annehmlichkeiten des heutigen Lebens gab es dazumal nicht.
Man hatte noch keine Sekundarschule dazumal. René war der Erste, der nach sechs Jahren Primarschule dorthin ging, nachdem sie Mitte der Vierzigerjahre in Leuk die Schule aufgemacht hatten. Ich musste stattdessen drei Jahre in die gleiche Klasse. Den Grund hierfür weiss ich nicht. Der Vater sagte, das gehe doch nicht. So haben sie mich abgemeldet. Meine Tante Marie, die Klosterfrau in Ingenbohl, sagte: «Schick sie mir doch, ich nehme sie schon.» Sie arbeitete dort als Lehrerin. Dann wohnte ich in zwei verschiedenen Familien in Brunnen und Ingenbohl und musste von Brunnen hinauf zur Schule laufen. Als ich manchmal bei Tante Marie übernachtete, machte sie immer die Läden zu. Ich war nicht offiziell bei ihr. Ich war nicht gerne dort, denn gelernt habe ich nichts. Am Schluss hat sie mir aber nur Einser ins Notenbüchlein geschrieben. Das war dazumal die beste Note.
Die Mutter wollte, dass alle Kinder, auch die Mädchen, etwas Richtiges lernen. Dass Mädchen eine Lehre machten, war in Varen zu jener Zeit nicht häufig der Fall. Im Dorf sagten sie, da habe man zu Hause so viel zu tun, da gebe man doch die Mädchen nicht weg. Aber meiner Mutter war das wichtig. Es war sie und nicht der Vater, die wollte, dass wir in die Fremde gingen. Das ist ihr hoch anzurechnen. Ich hätte gerne im Büro gearbeitet. Da ging ich nach Siders in ein Büro und fragte, ob ich dort die Lehre machen könne. Sie sagten mir, das sei möglich, ich müsse aber einen gewissen Betrag pro Monat dafür bezahlen. Kannst du dir das vorstellen, Geld zu bezahlen, ich als Erstgeborene! Da gab ich die Idee wieder auf. Ich bin die Einzige ohne Lehre, mit Ausnahme von Markus machten alle eine Ausbildung. Die Mutter hätte es mir bezahlt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihr das zu sagen, verstehst du. Onkel Pius meinte, ich hätte Lehrerin werden sollen, ich war gut in der Schule.
Als das mit der Büroarbeit nicht klappte, ging ich in die Stellen, ich ging servieren. Das war das Einzige, das man ohne Lehre machen konnte. Zuvor arbeitete ich aber noch in Sitten bei einer Familie mit vier Kindern, um Französisch zu lernen. Da war ich 16 Jahre alt. Dort verdiente ich 35 Franken im Monat. Die Mutter meinte, für die viele Arbeit von morgens bis abends sei das doch etwas zu wenig. Das sagte ich der Patronne [Chefin], die mir prompt den Lohn auf 40 Franken erhöhte. Das Jahr beendete ich aber trotzdem nicht, denn der Vater sagte: «Komm’ doch nach Hause, wir haben hier Arbeit für dich.»
Die erste richtige Stelle trat ich im Tearoom Singerhaus am Basler Marktplatz an. Kurz nach dem Krieg servierte ich dort Patisserie. Die Grenzen waren aufgegangen und die Leute aus Mulhouse strömten herbei. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Patisserie die assen, tellerweise verkaufte ich. C’était incroyable! [Das war unglaublich!] Das war etwas Spezielles für die, die hatten doch jahrelang keine mehr gegessen. Später fragte ich die Patronne, ob ich nicht nur Patisserie verkaufen, sondern auch Kaffee servieren könne. Da durfte ich servieren. Als ich 20 war, machte ich im Hotel St. Georges in Montana zwei Jahre lang den Saal. Franz und Mary arbeiteten im selben Hotel. Nach Montana war ich in Siders im Hôtel Bellevue. Danach in Zermatt im Hotel Seilerhaus, dort servierte ich auch Essen. So bin ich immer ein bisschen aufgestiegen. In Zermatt waren es Saisonstellen, da war ich zwei oder drei Mal. Ich erinnere mich, dass ich dort Fisch ausnehmen musste. Das hatte ich aber vorher noch nie gemacht. Der Patron [Chef] machte mir anschliessend ein Kompliment. Ich dachte, wenn der wüsste, dass ich das erste Mal Fisch ausgenommen hatte. Meine Mutter sagte immer: «Du musst mit den Augen lernen. Schauen.»
Danach war ich zwei Jahre im Restaurant Walliserkeller in Bern, da ich gehört hatte, dass es dort gute Arbeitsstellen gibt. Ich erhielt zwar keinen Lohn und das Zimmer musste ich selbst organisieren. Das Trinkgeld war aber grosszügig und so verdiente ich trotzdem relativ gut. Ich behielt nie einen Rappen selbst, sondern schickte immer alles heim. Da muss ich meiner Mutter ein Kompliment machen. Meine Eltern benötigten das Geld zwar, aber die Mutter legte immer einen Teil auf die Seite. An meiner Hochzeit gab sie mir ein Bankbüchlein. Das fand ich nett.
Читать дальше