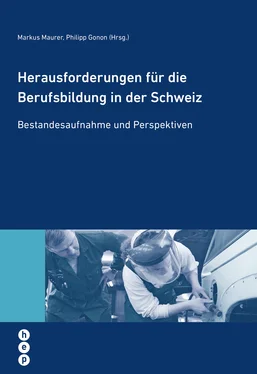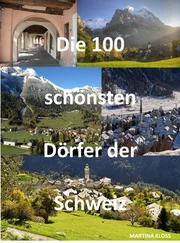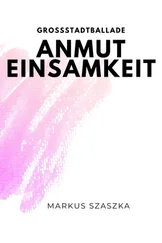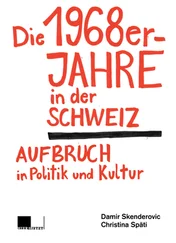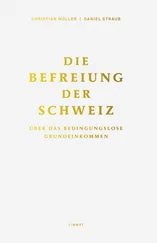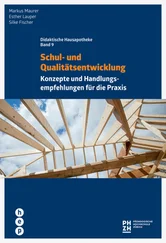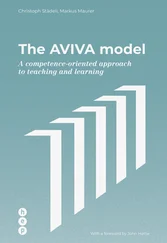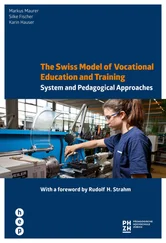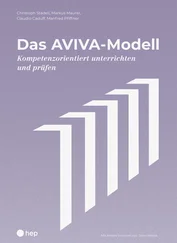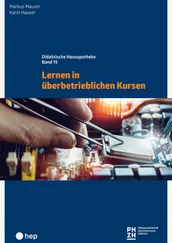Konkordanz- bzw. Konsensdemokratie
Das als drittes genannte Prinzip der Konkordanz respektive des Konsenses (Lehmbruch, 2003) ist keine formelle Verfassungsregel, sondern hat sich über die Zeit als Praxis etabliert. Ziel ist die möglichst breite Abstützung politischer Entscheide durch Herbeiführung eines Konsenses und damit den Einbezug einer Vielzahl von Akteuren (Parteien, Verbände, gesellschaftliche Gruppierungen usw.). Die grosse Bedeutung von Konsultationen und Vernehmlassungen im Gesetzgebungsprozess ist ein Ausdruck dieses Prinzips. Zugleich bergen diese dem Korporatismus und dem Konkordanzprinzip geschuldeten Verfahren die Gefahr, dass Entscheide nicht durch demokratisch legitimierte Institutionen, sondern im vorparlamentarischen Raum wenn nicht getroffen, so doch weitgehend vorstrukturiert werden (Lehner & Widmaier, 2002). Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Schwerfälligkeit von politischen Entscheidungsprozessen, die sich daraus ergibt, und die eher geringe Innovationsfähigkeit dieser Systeme (Lehner & Widmaier, 2002). Mit Bezug auf die Schweiz wird dieses Problem zum Beispiel immer wieder im Zusammenhang mit den Harmonisierungsbestrebungen im Bildungsbereich oder der Europapolitik angeführt.
Von der Problemdefinition zum neuen BBG
Institutionelle Regeln und Steuerungsprozesse in der jüngsten Berufsbildungsreform
Die Berufsbildungsdebatte im Vorfeld der jüngsten Reformen wurde Mitte der 1990er-Jahre auf parlamentarischer Ebene über verschiedene Vorstösse lanciert. Entsprechend erfolgte der «Filterungsprozess», der zu einer konzisen Problemdefinition und schliesslich zur Neuformulierung des BBG 2002 führte, unter der Regie der Bundesbehörden. Dass Initiierung und Verlauf einer Berufsbildungsreform nicht unbedingt auf diese Weise vonstattengehen muss, zeigen die Reforminitiativen im Vorfeld der Gesetzesnovellierung von 1978. Diese gingen zuerst von den kantonalen Berufsbildungsämtern, Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Fachverbänden des beruflichen Unterrichts aus (Schweizerischer Bundesrat, 1977). In der Folge erarbeitete der Schweizerische Gewerkschaftsbund parallel zu der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission einen alternativen Gesetzesentwurf; zudem ergriff der Gewerkschaftsbund nach Verabschiedung der Vorlage durch das Parlament das Referendum, wenngleich ohne Erfolg. Die Reform der Siebzigerjahre war insgesamt stärker von einem gesellschaftspolitischen Reformimpetus getragen. Die von der Linken und Fachkreisen formulierten Modernisierungs- und Pädagogisierungsforderungen fanden mit der Einführung obligatorischer Kurse für die Ausbilder, Modelllehrgängen, Mitspracherecht der Lehrlinge in Schulfragen, Einführung der Berufsmittelschule usw. zumindest eine teilweise Umsetzung.
Für die Darstellung der Problemdefinitions-, Entscheidungs- und Umsetzungprozesse anlässlich der jüngsten Berufsbildungsreform bietet sich der Rückgriff auf ein zyklisch-prozedurales Schema an, das folgende fünf Phasen unterscheidet: 1) Problem-(re-)definition, 2) Agenda-Setting, 3) Politikformulierung, 4) Politikumsetzung, 5) Politikevaluation (vgl. Knoepfel et al., 2011).
In den Achtzigerjahren machte sich ein Rückgang des Lehrstellenangebots und der Zahl abgeschlossener Lehrverträge bemerkbar, ein Abwärtstrend, der in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre seinen Tiefpunkt erreichte und zeigte, dass dringender Handlungsbedarf bestand. Unter dem Eindruck der «Lehrstellenkrise» forderten darauf verschiedene parlamentarische Vorstösse eine Revision des Berufsbildungsgesetzes und kurzfristige Massnahmen zur Förderung des Lehrstellenangebots. Einen wichtigen Akteur in dieser Phase stellte die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur dar, die die Lehrstellenbeschlüsse I (1997) und II (2000) erarbeitete.
Stimmen aus Politik und Wirtschaft hatten angesichts der prekären Lehrstellensituation Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der in der Schweiz traditionell vorherrschenden dualen Berufsbildung angemeldet. Im Parlament äusserte sich ein dezidierter Wille, die Zukunft der Berufsbildung angesichts der Krise zu sichern und ihr zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen, wobei sich überraschend schnell zeigte, dass eine Mehrheit aus Politik und Wirtschaft am etablierten Ausbildungsmodell festhalten wollte.
Die Stossrichtung der anstehenden Reform wurde erstmals vom Bundesrat im Rahmen seines Berichts über die Berufsbildung vom 9. November 1996 formuliert (Schweizerischer Bundesrat, 1996). Der Prozess der Konsensfindung war in der Einschätzung des Bundesrates zu jenem Zeitpunkt noch nicht genügend weit fortgeschritten, um grundlegende Reformen und einschneidende Massnahmen vorzubringen. Dafür wären die Ergebnisse aus den Diskussionen zur Reform der Bundesverfassung, der Regierungs- und Verwaltungsreform sowie zum neuen Finanzausgleich abzuwarten (Schweizerischer Bundesrat, 1996). In Zusammenhang mit letzterem Geschäft war immerhin die Möglichkeit einer Kantonalisierung der Berufsbildung kurzfristig zur Diskussion gestanden, jedoch von Fachkreisen des Bildungswesens wie auch von den Kantonen deutlich abgelehnt und schliesslich in der Vernehmlassung abgewehrt worden (vgl. Strahm, 2008). Aufgrund der gültigen Verfassung beschränkten sich die Vorschläge auf die BIGA-Berufe, doch äusserte der Bundesrat bereits den Willen, «seine Koordinations-, Aufsichts- und Steuerungskompetenzen in der Berufsbildung verstärkt für zukunftsweisende Rahmenbedingungen» einzusetzen (Schweizerischer Bundesrat, 1996, S. 6). Mittel dazu bildeten ein neuer Finanzierungsmodus und ein verstärktes finanzielles Engagement, da es sonst «dem Bund zunehmend schwerer fallen [würde], seine gestaltende Rolle im Interesse der Ausbildung in einem einheitlichen Wirtschaftsraum wahrzunehmen» (Schweizerischer Bundesrat, 1996, S. 71). Das Kernanliegen der Reform war in diesem Bericht bereits definiert: Angesichts der Problemlage galt es, die berufliche Bildung für die Jugendlichen attraktiver zu gestalten (z. B. Durchlässigkeit), ohne der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe Hindernisse in den Weg zu stellen; vor dem Hintergrund des technologischen und wirtschaftlichen Wandels sollte das duale Modell zudem auf die gestiegene Bedeutung anspruchsvoller Ausbildungsberufe mit entsprechendem schulischem Anteil hin weiterentwickelt werden. Schliesslich stand das schweizerische Berufsbildungssystem vor der Herausforderung, die Europakompatibilität seiner Ausbildung nachzuweisen und die Anerkennung der Abschlüsse voranzutreiben. 3
Diese Zielsetzungen machten es notwendig, die Berufsbildung dezidiert im Kontext und in Abhängigkeit vom Gesamtbildungssystem zu betrachten. Die «Krise der Berufslehre» stand zudem in Zusammenhang mit einem Trend zu längerer schulischer Ausbildung und insbesondere zu höheren Abschlüssen. In der bundesrätlichen «Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 2000–2003» vom 25. November 1998 wird diese Tendenz mit Sorge betrachtet (Schweizerischer Bundesrat, 1998). Die Botschaft stellt «ein Problem erhöhter Maturanden- und Studierendenzahlen» fest und statuiert das «Oberziel einer Plafonierung der Studierendenzahlen an den traditionellen Hochschulen (von ca. 15–20 % der relevanten Altersjahrgänge)», um die Universitäten zu entlasten (und die Studierendenzahlen an den Fachhochschulen zu erhöhen) (Schweizerischer Bundesrat, 1998, S. 319). Damit ist ein klares steuerungspolitisches Ziel benannt. Nach den geburtenstarken Jahrgängen war ab etwa 2008 wieder mit einem Rückgang der Absolventenzahlen der obligatorischen Schule zu rechnen (Babel, 2005) und damit mit einem verschärften Wettbewerb zwischen Berufsbildung und Gymnasien um «gute» Schülerinnen und Schüler.
Die Phase der Politikformulierung kam 1997 nach der parlamentarischen Debatte des genannten Bundesratsbericht über die Berufsbildung zu einem vorläufigen Abschluss. In einem nächsten Schritt setzte das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) im März 1998 eine Expertenkommission unter der Leitung des Direktors des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT; 1998 aus dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit BIGA hervorgegangen) ein, die einen Entwurf eines neuen Berufsbildungsgesetzes ausarbeiten sollte. Mit dem Entwurf, den die Kommission Anfang 1999 verabschiedete, war der Problemfilterungsprozess abgeschlossen und die Politik in groben Zügen definiert. Wesentlichen Bestandteil der Politikformulierung bildet im schweizerischen System allerdings die Vernehmlassung durch Repräsentanten von Politik, Bildung und Gesellschaft, hier vor allem bestehend aus den Kantonen und den Berufsbildungsämtern, Berufs- und Fachorganisationen, Parteien und Vertretern beruflicher Bildungseinrichtungen.
Читать дальше