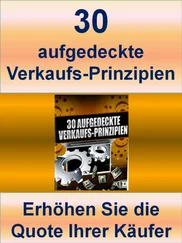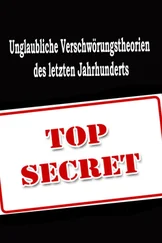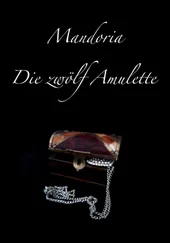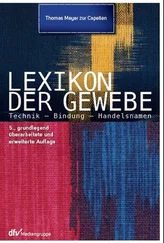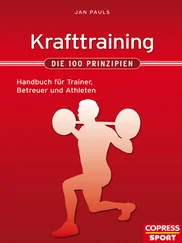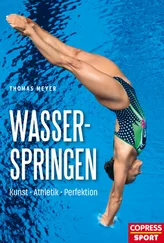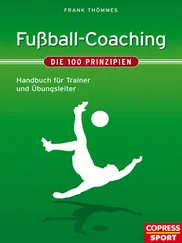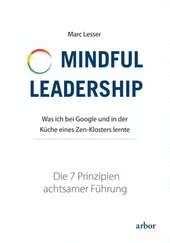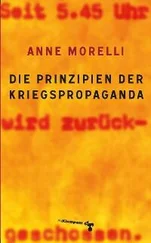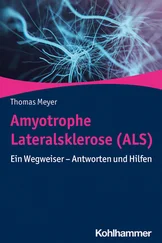→ Wettkampf (9)
→ Trainingsweltmeister (27)
→ Selbstkontrolle (40)
→ Selbststeuerung (43)
→ Lernen-Lehre (93)
→ Organisation (96)
→ Disziplin (98)
8
Übung macht den Meister
oder keinen: Über das Training
Am Anfang ist das Tun. Daraus entsteht das Üben. Das kann Lernen sein. Es kann durch das Lehren entstehen, das direkte oder indirekte oder durch Eigeninitiative und durch Selbstbeobachtung. Ziel ist die Beherrschung von Fertigkeiten – mehr oder weniger …
Training ist der Ausdruck für Übung, Schulung, Weiterbildung. Im Sport bezieht sich das Training auf die körperlichen Bewegungshandlungen, die mit psychischem Erleben, Entscheiden sowie Denk- und Lernprozessen verbunden sind.
Die Inhalte des Trainings bieten Reize, die der Organismus verarbeitet. Ob sie zur Ausbildung einer Fertigkeit führen, ist abhängig von den Fähigkeiten, der Motivation und Disziplin des Trainierenden sowie den pädagogischen und sportartspezifischen Kenntnissen des Trainers. Das familiäre Umfeld kann das Lernen durch Trainieren ebenso beeinflussen.
Die Intensität, Dauer und Häufigkeit der Trainingsreize sollte an das Lebensalter und den jeweiligen Leistungsstand angepasst sein. Zeit zur Anpassung und zur Erholung gehört zum Trainieren wie Reize und Belastungen.
Wann sind Trainingsreize nicht sinnvoll? Besteht darüber Einigkeit zwischen Sportler und Trainer?
Ein Beispiel aus dem Wasserspringen: Es ist Wettkampftag. Man befindet sich in der Schwimmhalle. Es bleiben drei Stunden Zeit vor dem Wettkampf. Der Sportler möchte ein paar Sprünge machen, um die Sprungbretter zu testen und sich an sie zu gewöhnen. Der Trainer verlangt ein 30-minütiges Training. Der Sportler sagt: »Trainer, das bringt doch jetzt nichts mehr, ich will mich lieber ausruhen.« Hingegen meint der Trainer: »Wir trainieren nicht für diesen Wettkampf, sondern für den Nächsten!«
Eigene Ideen der Sportler zur Gestaltung der Wettkampfvorbereitung und des Trainings können jeweils einen sinnvollen Raum einnehmen. Das Motiv für die ablehnende Haltung des Sportlers im vorgenannten Beispiel war nicht Faulheit, sondern die Sehnsucht, sich nach der eigenen Befindlichkeit orientieren und regulieren zu können. Das wurde vom Trainer nicht ernst genommen, und der jugendliche Sportler war nicht in der Lage, sich mit seiner Absicht durchzusetzen.

Das Erlernen dieser Selbstregulationskompetenz ist das Ziel des Psychologischen Trainings. Für dieses Training gelten die gleichen Prinzipien:
 Verschiedene Reize durch das Erlernen und die Anwendung verschiedener Übungsformen setzen.
Verschiedene Reize durch das Erlernen und die Anwendung verschiedener Übungsformen setzen.
 Den Sportlern Raum lassen, Übungsformen zu modifizieren und sie in den Alltag sowie in das sportliches Training und die Wettkampfvorbereitung zu integrieren.
Den Sportlern Raum lassen, Übungsformen zu modifizieren und sie in den Alltag sowie in das sportliches Training und die Wettkampfvorbereitung zu integrieren.
Es darf vom Sportler und in der sportpsychologischen Wissenschaft die Frage gestellt werden, wann psychologisches Training in welcher Form sinnvoll ist, und wann darauf verzichtet werden kann.
Entwickelt man psychologische oder gymnastische Trainingsformen für eine Allgemeinheit, ohne die einzelnen Trainierenden zu kennen, können Anweisungen so formuliert sein, dass die Gefahr von Missverständnissen und daraus resultierenden Fehlern möglichst klein ist.
Aus diesem Grund werden beim freien Bewegen das individuelle Wohlgefühl und ein individuelles freies Entscheiden des Trainierenden angesprochen und als Orientierungshilfe bzw. Regulationsrichtlinie genutzt.
VERWEISE:
→ Trainer (7)
→ Wettkampf (9)
→ Entspannungsverfahren (10)
→ Bewegungsregulation (11)
→ Psychophysische Regulation (12)
→ Freies Bewegen (19)
→ Psychologisches Training (21)
→ Improvisation (47)
→ Disziplin (98)
9
Der Wettkampf kann ein Spiel sein
Wetten, dass man spielerisch kämpfen kann, auch wenn es hart wird?
Der Wettkampf ist der Moment der Aufführung des Geübten, Trainierten.
Unabhängig von der Sportart ist der Moment des Wettkampfes ein anderer als der Moment des Trainings. Es ist der besondere Moment, auf den man hingearbeitet hat. Geht es im Training beispielsweise um das Einüben spezieller Fähigkeiten und Fertigkeiten, bei dem ein bestimmtes Maß an Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und Selbstreflexion notwendig ist, steht im Wettkampf das automatisierte, vertrauensvolle und improvisationsfähige Handeln im Vordergrund.
Im Wettkampf befinden sich die Sportler in einem besonderen psychischen und physischen Zustand. Dieser ist abhängig von der Bedeutung, die der Wettkampf für den Sportler hat und von den Erwartungen, die er daran knüpft.
Man unterscheidet verschiedene Belastungsphasen: Das sind Phasen vor, während und nach dem Wettkampf. Entsprechend der Phase befindet sich der Organismus in verschiedenen Zuständen und Erwartungen.
Eng an den Begriff der Aktivierung ist in der Sportpsychologie der sogenannte Vorstartzustand gekoppelt. Nimmt das Erregungsniveau des Organismus’ zu, verändert sich die Erregung im vegetativen Nervensystem, und die Muskelspannung erhöht sich. Im Vorstartzustand kann es zu solchen Erregungen kommen. Es gibt die Übererregung und die Untererregung. Beide können sich leistungsmindernd auswirken. Es ist zu beachten, dass das Erregungsniveau nie konstant ist, sondern permanent Schwankungen unterliegt.
Letztlich ist es der Sportler selbst, der wissen muss, wie sich sein Erregungsniveau auf seine Leistung auswirken kann. Allerdings ist die aktuelle Befindlichkeit nicht immer direkt zu deuten und zu verstehen.
Eine Schwimmerin berichtete von ihrem morgendlichen Vorstartzustand, dass es ihr so schlecht ergangen ist, sie sich schlapp, erschöpft und elend gefühlt hat, dass sie nicht wusste, ob sie am Abend an den Start gehen könne. Sie erschwamm den Weltrekord.

Der Versuch von »lockerer« Härte während des Wintertriathlons
Dieses Gefühl wird mitunter so beschrieben, als nehme der Organismus Anlauf: Auf den energielosen und -sparenden Zustand folgt eine sich immer stärker aufbauende Verfassung. Diese Zustände werden individuell unterschiedlich empfunden, erlebt und beschrieben. Es wird hier bewusst nicht von einem optimalen Zustand geschrieben. Er ist veränderlich und regulierbar.
Das wirft Fragen auf: Wie bereitet man sich auf einen Wettkampf vor? Wie geht man mit der psychophysischen Spannung, die sich vor einem Wettkampf aufbaut, um?
Für die Wettkampfvorbereitung ist es hilfreich, psychophysische Regulationskompetenz erworben zu haben. Dies schließt ein, dass man keine regulative Handlung einsetzt.
Während des Wettkampfes können je nach Sportart unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen sein. Während der sportartspezifischen Bewegungshandlungen können immer wieder Ereignisse geschehen, die so nicht erwartet würden. Auf diese kann man sich reaktionsschnell und locker einlassen. Dabei kann man aus dem Zustand der Selbstvergessenheit in die Selbstbeobachtung gelangen und umgekehrt.
Читать дальше
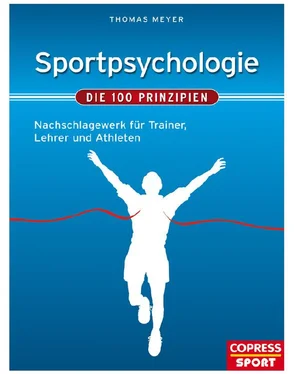

 Verschiedene Reize durch das Erlernen und die Anwendung verschiedener Übungsformen setzen.
Verschiedene Reize durch das Erlernen und die Anwendung verschiedener Übungsformen setzen.