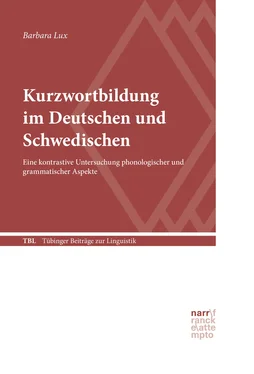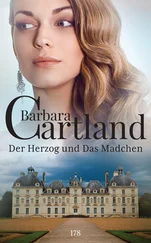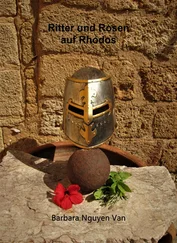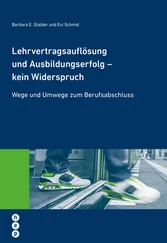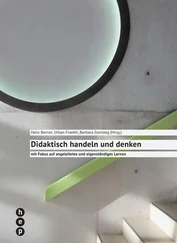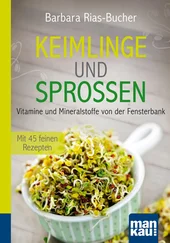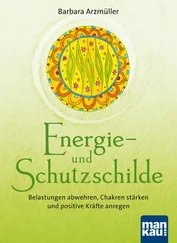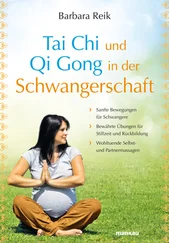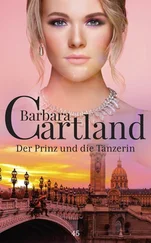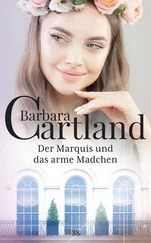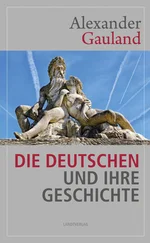Des Weiteren kann etwa der Begriff des Kürzungskompositums missverstanden werden. Zu verstehen ist er als Kompositum, dessen Erstglied aus einer Kürzung besteht. Er könnte jedoch auch dahingehend interpretiert werden, dass einem Kürzungskompositum ein Kompositum zugrunde liegen muss, das dann teilweise gekürzt wird. Diese Auffassung wäre jedoch unpräzise und würde nicht alle möglichen Fälle abdecken. Kürzungen wie E-Musik und H-Milch liegt zum Beispiel als Vollform kein Kompositum zugrunde, sondern die Phrase ernste Musik bzw. haltbare Milch . Auch im Schwedischen sind derartige Belege nicht zwangsläufig Kürzungen eines Kompositums, vgl. no-ämnen < naturorienterande ämnen ‚naturwissenschaftliche Schulfächer‘. Um der terminologischen Kontinuität willen wird der Begriff des Kürzungskompositums allerdings trotzdem beibehalten.
Auch der Typ der Silbeninitialwörter, bei anderen Autoren auch Silbenkurzwörter oder Silbenwörter genannt, muss kritisiert werden. Der Begriff impliziert, dass ganze Silben aus der Vollform in das Kurzwort eingehen, während dies jedoch äußerst selten der Fall ist. In der Regel besteht ein sogenanntes Silbenwort lediglich aus Silbenteilen der Vollform. In Schupo < Schutzpolizei wird beispielsweise von der ersten Silbe nur der Onset und der Silbenkern ohne die Koda übernommen; die vollständige erste Silbe der Vollform lautet Schutz . Gemeint ist mit diesem Begriff dagegen vermutlich, dass bei Kurzwörtern diesen Typs alle Silben des Kurzworts als Ganzes aus der Vollform entnommen wurden, was sich durch diesen Terminus jedoch nicht unmittelbar erschließt. Da aber trotz dieses Einwands die überwiegende Mehrheit der Autoren von Silbenwörtern, Silbeninitialwörtern oder Silbenkurzwörtern spricht, soll diese Begrifflichkeit auch in der vorliegenden Arbeit beibehalten werden und von Silbeninitialwörtern die Rede sein. Um den terminologischen Apparat nicht noch weiter zu belasten, wurden sämtliche Einzeltypen aus Nüblings Typologie mit ihren Bezeichnungen übernommen.
Während im Deutschen verschiedene ausdifferenzierte Typologien miteinander konkurrieren, existiert für das Schwedische keine einheitliche, etablierte Typologie. In der linguistischen Forschung zum Schwedischen wurde die Kurzwortbildung bislang generell nur wenig thematisiert (siehe dazu ausführlicher Kapitel 2.4.2). Im Hinblick auf die Terminologie ist die Situation im Schwedischen noch unklarer als im Deutschen, da dort verschiedene Begriffe wie „förkortning“, „stympning“, „avbrytning“, „ellipsord“, „initialord“ und „kortord“3 bei unterschiedlichen Autoren teilweise synonym oder auch als Ober- oder Unterbegriffe voneinander verwendet werden. Aus diesem Grund soll nach dem Vorbild von Nübling (2001) die für diese Arbeit etablierte deutsche Terminologie auch der Ausgangspunkt für die Analyse der schwedischen Belege sein. Wo in der Literatur bereits schwedische Termini für einen bestimmten Kurzworttyp vorgeschlagen wurden, werden diese im entsprechenden Unterkapitel erwähnt. In den folgenden Unterkapiteln sollen daher die in dieser Arbeit verwendeten Kurzworttypen nach Nübling (2001) anhand deutscher und schwedischer Beispiele vorgestellt werden.
Zur Gruppe der Akronyme zählen nach Nübling (2001:171–174) Buchstabierwörter, Lautinitialwörter und Silbeninitialwörter. Gemeinsam ist diesen Typen, dass das Kurzwort aus mehreren initialen Segmenten der Vollform (Buchstaben, Lauten oder Silbenteilen) besteht. Nach der Terminologie von Kobler-Trill (1994) handelt es sich bei Akronymen durchweg um multisegmentale Kurzwörter. Bis auf den Typ der Silbeninitialwörter werden Akronyme kaum spontan im mündlichen Sprachgebrauch gebildet, sondern entstehen meist in der Schriftsprache, da zur Bildung von Akronymen in sehr viel höherem Maße Bezug auf die morphologische Ausgangsstruktur genommen werden muss als bei der Bildung von Kurzwörtern i.e.S. Ronneberger-Sibold (1992:64) formuliert es folgendermaßen: „Die Akronymie ist also in mehreren Hinsichten eine sehr viel intellektuellere Kürzungstechnik als die Bildung von Kurzwörtern1.“ Trotz der unterschiedlichen Bildungsweise unterscheiden sich Akronyme in vielen Punkten nicht grundlegend von Kurzwörtern im engeren Sinne. Im Lauf der Arbeit wird sich zeigen, dass Akronyme etwa in phonologischer Hinsicht zum Großteil die bei Kurzwörtern im engeren Sinne beobachteten Präferenzen teilen. Es ist also durchaus gerechtfertigt, sie als Teil der Kurzwortbildung zu betrachten.
2.2.1.1 Buchstabierwörter
Bei Buchstabierwörtern werden die Anfangsbuchstaben von Bestandteilen der Vollform, zum Beispiel von Lexemen einer Wortgruppe oder Morphemen eines Kompositums, zu einem Kurzwort zusammengefügt und mit den entsprechenden Buchstabennamen ausgesprochen. Die Aussprache der Buchstaben des deutschen und schwedischen Alphabets ist in Tabelle 2 angegeben. Wie daraus zu erkennen ist, gibt es dabei bis auf wenige Unterschiede große Übereinstimmungen zwischen den Untersuchungssprachen. Im Deutschen haben 19 von 29, im Schwedischen sogar 22 von 29 Buchstabennamen einen vokalischen Auslaut. Dies ist besonders im Hinblick auf die Silbenstruktur der Kurzworttypen der Buchstabierwörter und Kürzungskomposita (siehe Kapitel 4.2) von Bedeutung, da Kurzwörter, die ganz oder teilweise mit Buchstabennamen gebildet werden, zwangsläufig einen hohen Anteil offener Silben enthalten.
| das deutsche Alphabet1 |
das schwedische Alphabet |
| A [aː] |
A [ɑː] |
| B [beː] |
B [beː] |
| C [tseː] |
C [seː] |
| D [deː] |
D [deː] |
| E [eː] |
E [eː] |
| F [ɛf] |
F [ɛf] |
| G [geː] |
G [geː] |
| H [haː] |
H [hoː] |
| I [iː] |
I [iː] |
| J [jɔt] |
J [jiː] |
| K [kaː] |
K [koː] |
| L [ɛl] |
L [ɛl] |
| M [ɛm] |
M [ɛm] |
| N [ɛn] |
N [ɛn] |
| O [oː] |
O [ɷː] |
| P [peː] |
P [peː] |
| Q [kuː] |
Q [kʉː] |
| R [ɛr] |
R [ær] |
| S2 [ɛs] |
S [ɛs] |
| T [teː] |
T [teː] |
| U [uː] |
U [ʉː] |
| V [faʊ] |
V [veː] |
| W [veː] |
W3 [ˇdɵbːɘl ̩veː] |
| X [iks] |
X [ɛks] |
| Y ['ʏpsilɔn] |
Y [yː] |
| Z [t͡sɛt] |
Z [ˇsɛːta] |
| Ä [ɛː] |
Å [oː] |
| Ö [øː] |
Ä [ɛː] |
| Ü [yː] |
Ö [øː] |
Tabelle 2: deutsches und schwedisches Alphabet
Beispiele für propriale und appellativische deutsche und schwedische Buchstabierwörter finden sich in Tabelle 3. Dieser Kurzworttyp ist im Deutschen sehr produktiv und deutlich häufiger als im Schwedischen, wie in Kapitel 3 deutlich werden wird.
| deutsche Buchstabierwörter |
schwedische Buchstabierwörter |
| AOK < Allgemeine Ortskrankenkasse |
AIK < Allmänna Idrottsklubben ‚allgemeiner Sportklub‘ |
| GEZ < Gebühreneinzugszentrale |
FP < Folkpartiet Liberalerna ‚Volkspartei die Liberalen‘ |
| IHK < Industrie- und Handelskammer |
KTH < Kungliga Tekniska Högskolan ‚Königlich Technische Hochschule‘ |
| MG < Maschinengewehr |
mc < motorcykel ‚Motorrad‘ |
Tabelle 3: deutsche und schwedische Buchstabierwörter
Typischerweise werden Eigennamen wie Namen von Organisationen auf diese Weise gebildet, z.B. dt. VDMA < Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau und schwed. LRF < Lantbrukarnas riksförbund ‚Reichsverband der Landwirte‘. Zum einen legen es deren oft sehr komplexe Vollformen nahe, eine gekürzte Form zu bilden, die in der Alltagskommunikation leichter zu handhaben ist. Des Weiteren ist die Akronymisierung eine Opakisierungsstrategie, mit der appellativische Interpretationen verhindert werden, die möglicherweise nicht mehr mit dem Referenten kompatibel sind, weil sich beispielsweise die Produktpalette oder die Ausrichtung der Organisation geändert hat.
Читать дальше