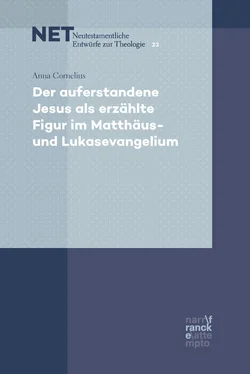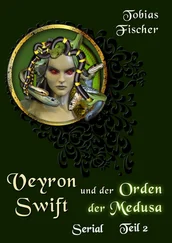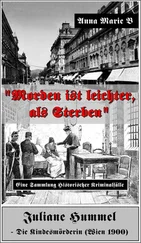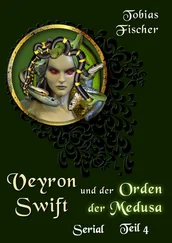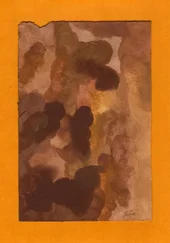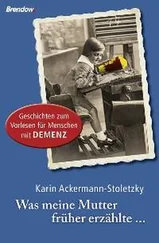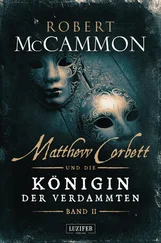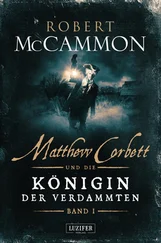Anschließend werden die verwendeten Begrifflichkeiten erklärt. 2.2.2.1 Erzählmodell Die im Vorangehenden kurz dargestellten Erzählmodelle haben m.E. jeweils ihre Stärken und Schwächen. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit durchgeführte Figurenanalyse des Auferstandenen scheint daher eine Kombination aus verschiedenen Modellen sinnvoll zu sein. Hinsichtlich der Einteilung einer Erzählung in verschiedene Ebenenschließe ich mich Chatman, Marguerat/Bourqin, Martinez/Scheffel und Fludernik an, die jede Erzählung grundsätzlich in das, waserzählt wird, und in das, wieetwas erzählt wird, also in Handlungund Darstellungeinteilen. Die von Genette als Narrationbezeichnete Situation des Erzählens sowie die von Schmid als Präsentation der Erzählungbezeichnete Verbalisierung der Erzählung kann m.E. zu Recht mit Martinez und Scheffel zu dem Bereich der Darstellunggezählt werden, da der Erzählermaßgeblich daran beteiligt ist, wieetwas erzählt wird. Hinsichtlich der Kommunikationssituationdient mir das Erzählmodell von Chatman als Basis, der den realen Autoraus der narrativen Untersuchung ausklammert und den Adressatenals nicht konstitutiv, sondern optional beschreibt. Anders als Chatman setze ich jedoch den Erzählerals konstitutiv voraus, da m.E. eine Erzählung niemals ohne Erzähler sein kann. Auch trenne ich den Erzähler– im Gegensatz zu Finnern – vom realen Autor, da es zwar große Übereinstimmungen zwischen diesen beiden Größen geben kann, sie jedoch in einer Erzählung (anders als in einer Autobiographie) nicht automatisch identisch sind. Zudem verwende ich in meinem Erzählmodell nicht den bei Chatman und Marguerat/Bourqin als Summe aller Erzählstrategien verstandenen Begriff impliziter Autor, sondern verzichte wie Genette bewusst auf diese Größe, da sie sich in Erzähltexten nur schwer vom Erzähler abgrenzen lässt und daher nicht wesentlich zur Erzähltextanalyse beiträgt. Auch wird der Begriff des impliziten Lesersin Anlehnung an Finnern gegen den Begriff des intendierten Rezipientengetauscht, der jedoch inhaltlich Schmids Zweiteilung in einen unterstellten Adressatenund in einen idealen Rezipientensowie Ecos Modellleserfolgt. Die Entscheidung für die Verwendung dieser Begriffe wird im Folgenden jeweils erläutert. Es ergibt sich daher als Grundlage für diese Arbeit folgendes Erzählmodell: Abb. 9 Das in dieser Arbeit verwendete Erzählmodell (eigene Darstellung) 2.2.2.2 Begriffsklärungen 2.2.2.2.1 Realer Autor Der reale Autorist eine historische Person oder eine Gruppe, die den Text produziert hat, sich dabei folglich außerhalb des Textes befindet. Für alle Erzählungen gilt: „Alle Texte sind von realen AutorInnen verfasst und werden von realen LeserInnen gelesen.“1 Sie und ihr Umfeld zu ergründen ist Aufgabe der historisch-kritischen Exegese. Der reale Autorexistiert „outside the text, independently of the text, and can only be reconstructed by historical hypothesis.“2 Daher ist er für die narrative Figurenanalyse von keiner Bedeutung.3 Wer der reale Autordes Matthäusevangeliums und wer der reale Autordes Lukasevangeliums war, in welchen sozialen und kulturellen Umwelten sie ihre Evangelien geschrieben haben, welche Quellen sie dabei verarbeitet haben und wie sie dabei vorgegangen sind, fällt nicht in den Bereich der Narratologie. 2.2.2.2.2 Realer Leser Beim realen Leserverhält es sich ähnlich wie beim realen Autor: Auch er befindet sich generell außerhalb des Textes. Dabei handelt es sich nicht um eine einzelne Person, sondern um eine unendlich große Anzahl an Menschen, die zu allen Zeiten den Text gelesen haben, lesen und lesen werden (die also später einmal zu realen Lesernwerden). 1 Zu rekonstruieren, wer die damaligen Erstleserdes Evangeliums waren, auf die der reale Autorsein Evangelium zugeschnitten hat, und wo das Evangelium seinen „Sitz im Leben“ gehabt hat, ist nicht Gegenstand der Narratologie. Denn was im Kopf der Erstleserbeim Lesen des Textes vorgegangen ist, welches Vorwissen und welche Verstehensprozesse sie an den Tag legten, kann nicht mehr rekonstruiert werden, da die realen Erstlesersowie der reale Autorim Dunkeln liegen. Dennoch bin ich als reale Leserinnatürlich faktisch an der Erzählung beteiligt, da ich mit meinen kognitiven Verstehens-Prozessen und aus meiner Lebenswelt heraus den Text wahrnehme.2 Bei dieser Wahrnehmung versuche ich jedoch, anhand bestimmter Textsignale die vom Text vorgesehene Rezeptionsweise (den intendierten Rezipientenund seine vom Text intendierten Reaktionen) zu rekonstruieren.3 Eco spricht dabei sogar von einer gewissen Verpflichtung des realen Lesers, sich dem Code und dem Verstehenshorizont des Modell-Lesersso weit wie möglich anzunähern.4 Darüber hinaus enthält der Text selbst Lese-Anweisungen für eine im Text vorgesehene Rezeptionsweise (den intendierten Rezipienten) und es geht dabei darum, diese Anweisungen aufzuzeigen, damit sich der reale Leserim Spielraum dieses intendierten Rezipientenbewegen kann.5 Der intendierte Rezipientist damit eine vom Text angebotene Lese-Rolle, die vom realen Lesereingenommen werden kann, auch wenn diese natürlich im Einzelnen von realen Lesern unterschiedlich eingenommen wird.6 2.2.2.2.3 Intendierter Rezipient In meinem Erzählmodell verwende ich anstelle des in vielen Erzähltheorien begegnenden Begriffs impliziter Leser1in sprachlicher Anlehnung an Finnern den Begriff intendierter Rezipient. Finnern versteht jedoch unter diesem Begriff das kognitive Bild, das sich der reale Autorvon seinem Leser gemacht hat. Parallel dazu existiert bei ihm das Bild, das sich der reale Leservom Autor macht.2 Jedoch muss mit Schmid bemerkt werden, dass hier „eine verführerische Symmetrie“3 naheliegt. Denn der Schwachpunkt an Finnerns Konzept des intendierten Rezipientenbesteht m.E. darin, dass wir in den Kopf des realen Autorsnicht mehr hineinschauen können und dass wir daher nicht wissen, welches Bild vom Lesersich der reale Autorgemacht hat.4 Diese „doppelte Brechung“ des Rezipienten als mentales Konstrukt eines im Dunkeln liegenden realen Autors scheint mehr als problematisch zu sein. Der intendierte Rezipientist daher in meinem Erzählmodell nicht der vom realen Autor, sondern der vom Text intendierte Rezipient. Der intendierte Rezipientnimmt dabei in meinem Erzählmodell zwei von Schmid5 herausgearbeitete Funktionen wahr: Er ist zum einen der unterstellte Adressat, der vom realen Leserdurch die Wortwahl des Erzählers und die von ihm verwendeten sprachlichen und kulturellen Codes rekonstruiert werden kann. Über die unterstellten Adressatendes Matthäusevangeliums kann z.B. gesagt werden, dass sie wahrscheinlich mit alttestamentlichen Texten vertraut waren, da der Erzähler an vielen Stellen alttestamentliche Zitate anbringt. Gleichzeitig ist der intendierte Rezipientaber auch ein idealer Rezipient, der jede Anspielung im Text versteht, ein Lesegedächtnis besitzt und über ein bestimmtes (historisches und kulturelles) Vorwissen verfügt. Der Text selbst und mit ihm der im Text intendierte Rezipientwird somit historisch sowohl im Matthäus- als auch im Lukasevangelium im 1. Jhd. n. Chr. verortet.6 Das mögliche Vorwissen des intendierten Rezipientenwird daher in den Fällen mit berücksichtigt, in denen der Text ein solches (historisches oder kulturelles) Wissen vorauszusetzen scheint und gezielt darauf anspielt. Dabei beziehe ich mich in diesem Punkt auf Eco und seinen Modelleser, der über ein bestimmtes, kulturell geprägtes enzyklopädisches Wissen verfügt.7 Darüber hinaus werden bei der Analyse des Textes das Lesegedächtnisdes intendierten Rezipienten(das die vorhergehenden Kapitel des Matthäus- oder des Lukasevangeliums umfasst) sowie seine wahrscheinlichen und im Text intendierten Reaktionenund Rezeptionsemotionen(wie Empathie, Sympathie, Antipathie, Spannung, Furcht, Freude, Humor)8 stets mit berücksichtigt. 2.2.2.2.4 Erzähler Der reale Autoreiner Erzählung schafft sich einen Erzähler, der dann eine Erzählung auf eine bestimmte Art und Weise erzählt.
Читать дальше