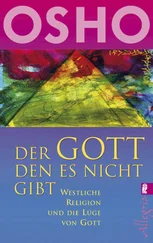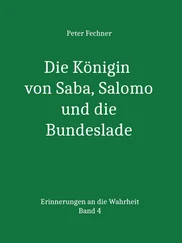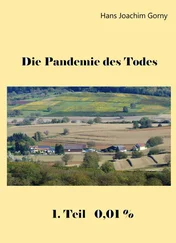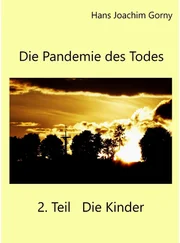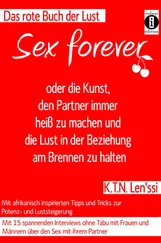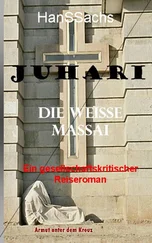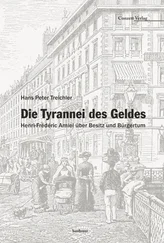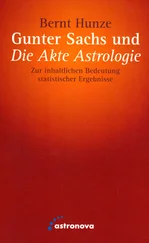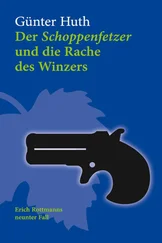| 1. Szene: |
Eine ältere arme Frau beschließt, ihr Geld mit Kupplerei zu verdienen. Sie will sich dafür im Dom umschauen. |
| 2. Szene: |
Sie entdeckt einen umherlaufenden Domherrn, spricht ihn an und erzählt, dass ihn eine junge Frau begehre. Für den Verkupplungsdienst bekommt sie von dem Domherrn Geld. |
| 3. Szene: |
Die Kupplerin will sich auf dem Markt nach einer Frau umschauen. |
| 4. Szene: |
Auf dem Markt sieht sie eine Frau, die gerade mit ihrer Magd einkauft. Die Kupplerin erzählt ihr von einem adligen Verehrer. Die Frau ist unsicher, woraufhin die Magd sie überredet, sich mit dem geheimen Verehrer zu treffen. |
| 5. Szene: |
Die Kupplerin will den Domherrn abholen, der jedoch nicht mitgehen kann, weil ihn der Bischof zu sich hat rufen lassen. Die Kupplerin muss einen anderen Mann suchen. |
| 6. Szene: |
Währenddessen hat sich der Ehemann der Frau auf die Suche nach ihr gemacht und ist auf dem Weg zum Markt. Da begegnet er der Kupplerin, die ihm erzählt, dass eine adelige Frau ihn begehrt. Er geht mit ihr mit. |
| 7. Szene: |
Die Magd und die Frau sehen die Kupplerin mit dem Ehemann kommen. Die Magd rät der Frau, nicht zu fliehen, sondern den Mann eines Betruges zu beschuldigen. Das tut sie, woraufhin sich der Mann entschuldigt. Die Frau fragt die Magd, woher sie wusste, dass dies funktioniere. Darauf antwortet die Magd, dass sie zwei Jahre einer adligen Frau gedient habe und die Tricks kenne. Die Frau beschließt das Spiel, indem sie bekundet, in Zukunft keiner Kupplerin mehr zu trauen. |
Eine Kette aus drei Monologen bildet den Einstieg in das Fastnachtspiel. Den ersten (vv. 1–32) spricht die Kupplerin. Strukturell-gliedernd liegt hier ein Auftritt-Abgangs-Monolog vor, genauer: ein Expositionsmonolog, weil vv. 1–20 als externe Analepse die Lebenshintergründe der Kupplerin wiedergibt. Es handelt sich demzufolge auf der Figurenebene um eine Selbstcharakterisierung, die den gesamten Monolog durchzieht:
|
Ach, was sol ich nun fahen an? |
|
Mein Geltlich ich verzehret han |
|
Mit schwerer Kranckheit lange Jar, |
|
Welches Gelt ich einsammlen war |
| 5 |
Mit Bulerey in meiner Jugendt, |
|
Da mir denn hauffenweiß zu trugent |
|
Edel, vnedel, Layen vnd Pfaffen. |
|
Nun bin ich heßlich, vngeschaffen, |
|
Zum buln mein niemand mehr begert, |
| 10 |
Bin ich auch verachtet vnd vnwert |
|
Vnd thu mich doch deß Betels schemen, |
|
Daß ich solt das Almusen nemen, |
|
Mag auch nit spinnen an eim Rocken, |
|
Mag auch bey keinem Krancken knocken, |
| 15 |
Auch nit den Kindern zopffn vnd lausen. |
|
Sol ich mich den nehren mit mausen, |
|
So hab ich sorg der meinen Ohrn; |
|
Mir ist die Statt vor versagt worn |
|
Von wegen meiner boͤsen stuͤck; |
| 20 |
Ich denck gleich hinter mich zu ruͤck. |
Vv. 21–32 vermittelt als zukunftsungewisse Prolepse die Absicht, Geld mittels Kupplerei zu verdienen:
|
Wil mich nun gleich mit Kuppeln nehrn, |
|
Dieselben kunst darff ich nicht lehrn, |
|
Bin gschwind durch mein arglistig renck, |
|
Darmit verdien ich danck vnd schenck, |
| 25 |
Dieweyl gantz abwegs steht mein Hauß, |
|
Ist recht gut darzu vberauß, |
|
Daß ich drinn zsamm kuppel ein paar, |
|
Daß sein sonst niemand wird gewar. |
|
Was steh ich, ich wil nein in Thumb, |
| 30 |
Nach eim Thumbherren sehen vmb, |
|
Mein handel kecklich fahen an, |
|
Dieweyl ich sonst nichts hab zu than. |
Leitet Sachs hier den Monolog zu Beginn des Fastnachtspiels im Nebentext mit der Regieanweisung „redet mit jhr selb“ ein, kam die Exposition im vorreformatorischen Fastnachtspiel noch dem Precursor zu, wie sich unschwer der Vorlage (vv. 4–12) entnehmen lässt:
|
Got gruß den wirt in hohen eren |
| 5 |
Und was im got ie tet bescheren |
|
Und alles, das das sein antrifft! |
|
Hie kumpt von Banberg auß dem stift |
|
Unsers herrn bischofs sigler her. |
|
Herr wirt, der leßt euch piten ser, |
| 10 |
Das er bei euch hie sigeln het, |
|
Der wird sich fugen wol herein, |
|
Des wolt mein herr euch danken sein. |
In gleicher Weise wie der Precursor bzw. Einschreier von der Publikumsrealität – in diesem Fall das Wirtshaus als Aufführungsort – in das Spiel überleitet, leitet der Ausschreier am Ende des Spiels wieder in diese zurück.9 In der Vorlage übernimmt diese Funktion bereits eine spielinterne Figur, der Knecht, der auch explizit die Funktion des Ausschreiers im Nebentext ausfüllt: „Tumherrn Knecht ist Auszschreier“ (S. 282 v. 3). Er gibt das uneindeutige Ende dem Publikum zur Diskussion frei, indem er den Wirt auffordert mitzureden, in die Wirtshausatmosphäre übergeht und zum Tanz bittet (S. 281 v. 31 – S. 282 v. 9):
|
|
Hor, freunt, schlag nit die alten huren, |
|
|
Laß dich kein kupplerin anfuren! |
|
|
Herr wirt, redt auch zu den sachen! |
|
|
Pauker, du solt ein tanz uns machen, |
|
|
Damit ein end und pald darvon, |
|
|
Wann wir noch weit haben zu gan. |
|
|
|
|
Tumherrn Knecht ist Auszschreier: |
|
|
|
|
|
Herr wirt, nu gebt uns euren segen, |
| 5 |
|
Nit von essens noch trinkens wegen, |
|
|
Als man zu gastung laden tut. |
|
|
Neur das wir euch ein guten mut |
|
|
Mochten machen, was unser sind hir in. |
|
|
Got gesegen euch all! Wir faren von hin. |
Die Ansprachen des Wirts zu Beginn und Ende und die Aufforderung zum Tanz verdeutlichen die für das vorreformatorische Fastnachtspiel typischen Grenzüberschreitungen zwischen Schauspielern und Rezipienten.10 Grundlage hierfür ist die Verortung im Aufführungsrahmen, wenngleich die Fixierung in Lesehandschriften erfolgt.
Die Einheit von Publikum, Bühne und Darstellern ist dem Fastnachtspiel des Spätmittelalters selbstverständlich. Die Aufführung vollzieht sich in engstem Kontakt zu den Zuschauern. Die Spieler sprechen die Zuschauer an, gehen (vermutlich) unter sie, werben um Wohlwollen (und indirekt wohl auch um Entlohnung), fordern am Schluss der Stücke zu Musik und Tanz auf.11
Nach Pfisters Terminologie handelt es sich um Grenzüberschreitungen zwischen dem inneren und äußeren Kommunikationssystem, die dem Precursor oder im Fall des Fastnachtspiels K 37 der Spielfigur des Knechtes die Rolle eines vermittelnden Kommunikationsteilnehmers zukommen lassen.12
In den frühen Fastnachtspielen bis 1549 und vereinzelt auch noch danach wählt Sachs eine schon in K 37 teilweise gebrauchte Zwischenform der Einschreier- und Ausschreier-Rede, bei der spielinterne Figuren diese Reden übernehmen. Mit der Einleitungsformel ‚redt mit jhr/jhm selb‘, die erstmals 1544 im Nebentext des Fastnachtspiels G 16 ausgewiesen ist, wenn auch nicht zu Beginn, unterstreicht Sachs den Monologcharakter gegenüber der Begrüßung des Publikums, die zu erwarten wäre.13
Читать дальше