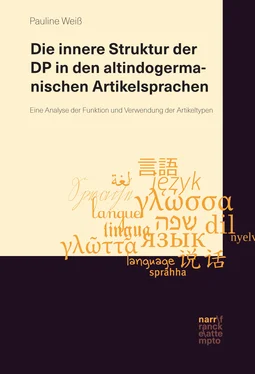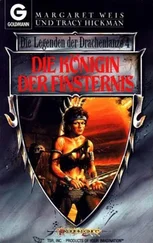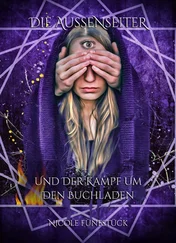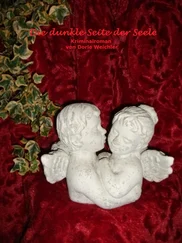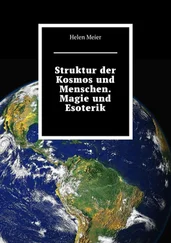Deiktische Verweise in Texten sollen dem Leser, ebenso wie in einer Gesprächssituation, bei der Orientierung helfen. Sie können Relationen zwischen Phrasen innerhalb des Textes, aber auch zwischen verschiedenen Texten herstellen. Matrëngas Werk bspw. ist ein Katechismus, der mitunter Bezug nimmt auf bestimmte Gebete, die im christlichen Glauben verankert sind. Matrënga geht somit davon aus, dass sein Leser diese kennt, d.h. er referiert auf andere Texte.
Bei der Rezeption von Texten liegt zwar keine Kommunikationssituation wie in einem Gespräch vor, dennoch spielen Deiktika eine wichtige Rolle. Speziell der Artikel ist ein vielseitiges deiktisches Mittel, das im Folgenden im Detail untersucht wird.
I.6 Der Artikel in den Untersuchungssprachen
Um den Artikel adäquat untersuchen zu können, muss zunächst eine Arbeitsdefinition formuliert werden, die im Laufe der Analyse spezifiziert werden kann.1 Daher werden in diesem Kapitel zunächst die grundlegenden Merkmale der Kategorie Artikel vorgestellt und beschrieben. Diese reichen von semantischen bis hin zu pragmatischen Aspekten, wobei letztere in der allgemeinen Darstellung zwar berücksichtigt, aber in der anschließenden Analyse vernachlässigt werden, da dort grammatische und syntaktische Eigenschaften im Fokus stehen.
Nach der sprachübergreifenden Darstellung des Artikels erfolgt die Erläuterung der einzelsprachlichen Artikeltypen. Diese konzentriert sich bereits vorrangig auf grammatische Eigenschaften und Funktionen des jeweiligen Artikels in der entsprechenden Untersuchungssprache. Spezielle Merkmale, die nicht zu den gut untersuchten Funktionen der Artikel zählen, werden teils erst im Verlauf der Arbeit anhand entsprechender Belegstellen herausgearbeitet. Hier geht es darum einen Überblick zu vermitteln.
Zudem wird an dieser Stelle zunächst angenommen, dass die fraglichen Morpheme alle Artikel sind. Ob dies wirklich zutrifft und alle Artikeltypen der Untersuchungssprachen tatsächlich als Artikel und somit als Determinantien klassifiziert werden können, wird im Kapitel II erforscht.
I.6.1 Zur Kategorie Artikel allgemein
Der Terminus Artikel leitet sich von dem lateinischen Wort articulus her und bedeutet ‚Gelenkchen‘. Der lateinische Ausdruck ist eine „Übersetzung“ des griechischen grammatischen Begriffs gr. ἄρθρον ‚Glied, Gelenk‘, der schon seit dem 4. Jh. v. Chr. im Gebrauch ist. Im Allgemeinen wird der Artikel als Begleiter des Nomens beschrieben. Ein Artikel kann als freies oder gebundenes Morphem auftreten. Dabei ist er immer phonologisch sowie morphologisch abhängig vom Kopfnomen, d.h. er kann nicht ohne Bezugselement stehen.
Die Kategorie Artikel gliedert sich in definiten, indefiniten und Nullartikel. Der Nullartikel ist in der Oberflächenstruktur der Sprache nicht zu sehen, dennoch modifiziert er eine Phrase. Das bedeutet, auch wenn in einer nominalen Phrase kein Artikel zu sehen ist, wird mitunter angenommen, dass ein Nullartikel vorhanden ist und z.B. Kasusmarkierung auslöst. Allerdings ist der Nullartikel umstritten. Während Engel (2004) bspw. den Nullartikel befürwortet1, sprechen andere Forscher stattdessen von Artikellosigkeit. Pérennec (1993) fasst dies im Bezug auf den Artikel in Texten wie folgt zusammen:
„… Auf der Ebene des Textes aber kann nur von einer Opposition zwischen Artikelsetzung und Artikellosigkeit die Rede sein, wobei Artikellosigkeit nicht mit einem Nullzeichen gleichgesetzt wird, sondern die Entbehrlichkeit jedes expliziten Determinans anzeigt. …“2
Für die vorliegende Arbeit ist das Vorkommen des Artikels innerhalb von Texten von vorrangigem Interesse, da von den alten Sprachen natürlich keine gesprochenen Zeugnisse existieren. Aufgrund des Fokus der Untersuchung kann hier nicht entschieden werden, ob die Annahme eines Nullartikels sinnvoll ist oder nicht. Ich gehe von Pérennecs (1993) eben genanntem Fazit aus und bespreche den Nullartikel nicht weiter.3
Ferner herrscht in den Grammatiken der deutschen Sprache Uneinigkeit darüber, wie der Artikel einzuordnen ist. Einige Forscher sprechen von Artikelwörtern, wozu neben dem Artikel auch Possessiva zählen. Per definitionem darf aber maximal ein Artikelwort vor einem Nomen stehen.4 Doch in einigen Sprachen können Possessivpronomina mit einem bestimmten Artikel in einer Phrase vorkommen, d.h. sie teilen das gleiche Kopfnomen. Daher wird die Klassifikation Artikelwörter abgelehnt. Engel (2004) nimmt eine Klasse Determinative an. Ein Determinativ ist ein „… obligatorischer Satellit des Nomens …“.5 Diese Kategorie umfasst neben dem Artikel auch Possessiva, Demonstrativa/Definita, Indefinita, Negativa und Interrogativa. Noch weiter gefasst ist der Begriff Determinierer6 oder Determinator.7 Neben Artikel und Pronomina werden auch quantifizierende Elemente in diese Klasse gerechnet. In dieser Untersuchung werden Pronomina jedoch als deklinierbare Wörter, die in der Regel anstelle einer Nominalgruppe auftreten, verstanden. Ein Artikel kann demgegenüber nicht ohne ein Bezugswort stehen. Zudem kann ein Artikel ein flektierendes oder invariables Morphem sein. Somit wird von einer Zuordnung des Artikels zu den Pronomina abgesehen. Quantifizierer übernehmen eine gänzlich andere Funktion als Artikel. Sie dienen der Mengen- und Größenangabe, während der bestimmte Artikel vorrangig Definitheit markiert. So wird weder mit der Kategorie Determinativ noch mit der Klasse Determinierer gearbeitet, da beide zu unscharf definiert sind. Denn dann, wie Vater (1979) erläutert, müssten auch Adjektive in die Klasse der Determinative eingeordnet werden. Schließlich sind sie ebenfalls verbindliche Begleiter von Nomina und bestimmen diese näher.8 Diese Kritik kann auch am Begriff Determinierer vorgenommen werden.
In dieser Arbeit ist der definite Artikel als Determinans klassifiziert. Ein Determinans wird als funktionales Element definiert, das die Komplement-NP beeinflusst (vgl. Kap. I.4.2). Zu dieser Kategorie zählen neben dem Artikel auch Demonstrativa. Determinantien können sowohl transitiv als auch intransitiv sein. Wenn sie transitiv sind, haben sie ein nominales Komplement. Erscheinen sie aber intransitiv, dann weisen sie kein Komplement auf, sondern sind pronominal. Possessiva gehören nicht in diese Kategorie, da sie in der Funktion als Pro-Form einen Genitiv substituieren können, d.h. sie anaphorisieren. In dt. sein Bleistift ersetzt das Possessivum dt. sein z.B. einen Eigennamen im Genitiv, wie dt. Peters Bleistift . Auch Olsen (1991) ordnet die Possessiva nicht den Determinantien zu. Sie schreibt: „… Possession ist eine zweistellige Relation, die zwischen einem Besitzer und einem zweiten Objekt besteht. …“9 Wenn ein Possessivum den Platz des Determinans einnehmen würde, könnte es diese zweistellige Relation nicht mehr deutlich ausdrücken. Die Possessiva können schon allein aus dem Grund nicht zu den Determinantien gerechnet werden, weil sie in einigen Sprachen gleichzeitig mit einem Determinans auftreten können. Schließlich lässt die Struktur der Determinansphrase nur jeweils ein Determinans zu.
Während das Nomen das lexikalische Material stellt, ist ein Artikel semantisch leer. Er besitzt keinen deskriptiven Inhalt, sondern ist ein grammatisches Mittel, das der Determination dient, i.e. er ist ein funktionales Element. Ein bestimmter Artikel hat die Aufgabe, eine Nominalphrase als [+definit] zu markieren, d.h. im Falle des Artikels, dass das Nomen, das er begleitet, für etwas Konkretes steht (vgl. Kap. I.5.1). Der Artikel erfüllt demnach die Funktion, Bekanntes gegen Unbekanntes abzugrenzen, oder in anderen Worten: Identifizierbarkeit gegenüber Unidentifizierbarkeit auszudrücken. Wird ein Element als bekannt markiert, dann handelt es sich um etwas, das entweder bereits erwähnt wurde oder allgemein bekannt sein dürfte.10
Читать дальше