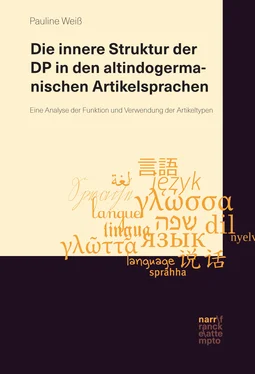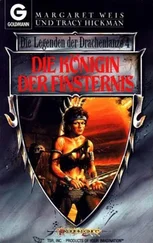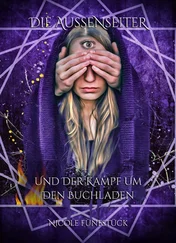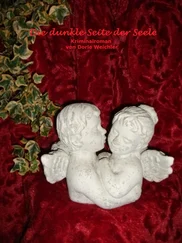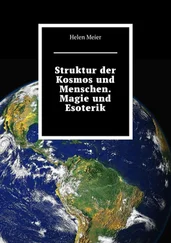1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 In der Regel fungiert ein definiter Artikel als default-Definitheitsmarker. Definitheitsmarkierung ist zwar die Hauptfunktion eines bestimmten Artikels, ist aber nicht allein auf diese grammatische Kategorie beschränkt, denn Pronomina oder attributive Elemente können ebenfalls zur Determination eingesetzt werden. So erhält bspw. ein Nomen, das durch ein Possessivpronomen oder ein Genitivattribut spezifiziert wird, einen gewissen Grad an Definitheit. Nomina, die durch weitere Elemente näher bestimmt werden, so dass ihre Referenz stärker markiert wird, werden also auch in gewisser Weise als [+definit] markiert. Gerade in alten Sprachen ist diese Überlegung wichtig, da diese einen Artikel, der in erster Linie Definitheit darlegt, erst ausbilden oder noch nicht besitzen. Dennoch sind diese Sprachen auch in der Lage Definitheit auszudrücken. Eine Phrase ist immer dann definit, wenn der Hörer/Leser einen passenden Referenten ermitteln kann, sei es durch Weltwissen oder durch spezifizierende Elemente.
Ferner ist für artikellose Sprachen, wie bspw. Latein, Löbels (1990) Vorschlag interessant. Demnach ist Definitheit in artikellosen Sprachen den Nomina inhärent. In ihrem Lexikoneintrag ist das Merkmal [+determiniert] verankert. Der Ausgangspunkt für diese Annahme ist das Beispiel lat. cani , das „… sowohl als ‚dem Hund‘ (d.h. definit) als auch als ‚einem Hund‘ (d.h. indefinit) interpretierbar [ist] …“.5 Die Interpretation von definit oder indefinit ist folglich kontextabhängig. Nur wenn ein Nomen nicht inhärent [+determiniert] ist, muss ein Marker genutzt werden, um Definitheit zu markieren. Pérennec (1993) kritisiert allerdings an Löbels Vorschlag, dass „… [d]ie kontextuellen Einwirkungen […] bei diesem Modell nicht berücksichtigt werden […] können. …“6 Dies ist ein Problem, denn ist ein Wort als [+determiniert] im Lexikon verankert, scheint es nicht möglich, es ohne Weiteres als indeterminiert zu interpretieren. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich jedoch auf Definitheit in Phrasen aus bestimmtem Artikel und Bezugswort, d.h. das grammatische Konzept wird vorrangig im Hinblick auf die zu analysierende Klasse respiziert. Definitheit in artikellosen Sprachen wird hier nicht weiter berücksichtigt.
I.5.2 Zum Konzept der Deixis
Deixis bedeutet sprachliches Zeigen. Sprachliche Ausdrücke, die eine weisende Funktion haben, werden Deiktika genannt. Deiktische Morpheme verweisen auf außersprachliche Elemente, sogenannte Referenten oder Denotate1, und setzen diese in einen Bezug zum Sprecher. Jeder Sprecher ordnet die Welt aus seiner Sicht und „… [überträgt] seine Perspektive in die Sprache […] …“.2 Dieser subjektive Ausgangspunkt, der stets reflexiv wirkt, heißt Origo. Die Origo wird durch die Position des Sprechers im Raum-Zeit-Gefüge definiert, d.h. sie ist für jeden Sprecher individuell. In Blühdorns (1995) Worten ist die Origo der unmarkierte Nullpunkt, d.h., man kann sich die Origo als Nullpunkt in einem Koordinatensystem vorstellen, von dem aus die Welt und die bezeichneten Denotate geordnet und beschrieben werden.3 Aber Deixis gibt nie einen exakten Ort an, sie weist nur in Richtung des Denotats. Dabei kann sie unterschiedliche Entfernungsstufen markieren. In der Theorie der Deixis spricht man von origoinklusiv und origoexklusiv. Ein Referent in der Nähe der Origo ist origoinklusiv, während ein entferntes Denotat origoexklusiv ist.
Ferner wird das Konzept Deixis in verschiedene Dimensionen untergliedert, z.B. in personale oder objektale.4 Anhand der Kategorie Dimension werden die Eigenschaften des Referenten beschrieben. Die personale Dimension kennzeichnet die Kommunikationsrollen Sprecher und Hörer, d.h. die personale Dimension schließt nur die erste und zweite Person ein. Die dritte Person dagegen wird der objektalen Dimension zugewiesen. Diese bestimmt alle denotierbaren Elemente, die keine Kommunikationsrolle besitzen. Laut Diewald (1991) sind in dieser Gruppe, neben dem Personalpronomen der dritten Person, die Demonstrativpronomina sowie der definite Artikel versammelt. Ihnen ist gemeinsam, dass sie (im Gegensatz zu den Personalpronomen der ersten und zweiten Person) Genus unterscheiden und „… einen echten […], nicht nur einen morphologischen Plural auf[weisen]. …“5 Festzuhalten ist, dass die objektale Dimension keine Gesprächspartner denotiert, sondern nur auf Referenten, die nicht aktiv an einer Kommunikationssituation teilnehmen, verweist.
Deixis ist immer reflexiv. Es gehört zu den Aufgaben der Deiktika, diese Relation zu gewährleisten. Es gibt schwache und starke Deiktika. Bei den erstgenannten ist die reflexive Funktion nur schwach ausgebildet, da das Deiktikon keine Suchanweisung nach einem Rückbezugselement vermittelt, d.h. der Rückbezug zur Origo ist defektiv bzw. unvollständig. Der deutsche Artikel, der den schwachen Deiktika zugeordnet wird, verdeutlicht dies gut. In dt. der Hund wird durch den Artikel auf einen bestimmten Hund referiert, aber die Phrase enthält keinen Hinweis auf die Origo. Heißt es aber dt. der Hund hier , wird eine Origo offenbar, d.h. der Hörer muss einen Rückbezug zum Sprecher herstellen. Dt. hier ist also ein starkes Deiktikon. Starke Deiktika können erfragt werden (vgl. dt. Wo ist der Hund? – Hier .).
Ferner können Deiktika nach Entfernungsstufen gegliedert werden. So setzt Brugmann (1904) vier Entfernungsstufen an. Diese heißen Dér-Deixis, Ich-Deixis, Du-Deixis und Jener-Deixis.6 Die Dér-Deixis markiert eine kurze/kleine Entfernung. Sie ist diejenige Zeigart, die am häufigsten in den Einzelsprachen anzutreffen ist. Sie steht im Gegensatz zur Ich-Deixis, in der der Sprecher von sich selbst bzw. von Dingen in direktem Bezug zu sich selbst spricht. Dadurch ist die Ich-Deixis in der Zeit, in der sich der Sprecher befindet, verankert. Sowohl Dér- als auch Ich-Deixis stehen, laut Brugmann (1904), der Opposition von Nähe und Ferne gleichgültig gegenüber. Später in seinem Werk schreibt Brugmann (1904) jedoch, dass sich mit der Ich-Deixis „… leicht der Begriff des Nahen …“7 verbinden lässt. Hier wird angenommen, dass Ich-Deixis Nähe impliziert, da sie nur auf Elemente referiert, die entweder lokal betrachtet nah zum Sprecher liegen, sich also in seinem Sichtfeld befinden, oder auf Umstände, die den Sprecher direkt betreffen. Zugleich kann eine Opposition von Nähe und Ferne der Theorie der Deixis nur inhärent sein, wenn es verschiedene Zeigarten gibt, die auf unterschiedliche Distanzstufen referieren. Du-Deixis ist eine Unterart der Dér-Deixis. Gleichzeitig ist sie das Pendant zur Ich-Deixis, d.h. sie tritt nur in Sprachen auf, die auch Ich-Deixis kennen. Jener-Deixis schließlich verweist auf etwas entfernt Liegendes, stellt also Ferndeixis dar. Dabei gehen räumliche und zeitliche Distanz Hand in Hand. So kann der Verweis auf etwas Entferntes sowohl etwas in der räumlichen Ausdehnung entferntes sein, aber auch etwas, das in der Zeit weit zurückliegt. Als Grundbedeutung gibt Brugmann (1904) „… ‚der übernächste, der vorletzte, vorvorige‘ …“8 an. Dabei kann diese Art der Deixis auch anaphorische Verwendung finden. Eine Gemeinsamkeit der Dér- und der Jener-Deixis ist, dass sie auf Personen im Sinne von „der Bekannte“ verweisen können. Die betreffende Person muss allerdings allgemein bekannt sein.
Da sich die vorliegende Arbeit mit überlieferten Texten beschäftigt, erfolgt ein kurzer Verweis auf die Textdeixis. Ehlich (1983) macht darauf aufmerksam, dass sich die Kommunikationssituation bei Texten ändert. So schreibt er, dass es zwei verschiedene Situationen in der „Sprechhandlung“ gibt. Zunächst findet eine Sprechhandlung statt, in der der Text niedergeschrieben wird, aber zu diesem Zeitpunkt ist kein Kommunikationspartner vorhanden. Ehlich (1983) nennt das „… Situationen der Sprechhandlung ohne den End-Adressaten …“.9 Später, wenn der Text gelesen wird, ist der End-Adressat zur Stelle, aber der Produzent, i.e. der Schreiber, ist abwesend. Nach Ehlich (1983) ist das „… eine zweite Sprechsituation ohne den ursprünglichen Sprecher …“.10 Die Kommunikationssituation ist in Texten also verschoben. In dem untersuchten Material trifft dies zu, da sich der heutige Leser in der zweiten Situation befindet. Die Autoren der Texte setzen natürlich entsprechendes Welt- und Allgemeinwissen des Lesers voraus. Allerdings unterscheidet sich dies erheblich bei einem heutigen Leser im Gegensatz zu einem Leser zur Zeit der jeweiligen Werke. Ein heutiger Rezipient der Texte muss sich mitunter erst Hintergrundwissen aneignen, bevor er jeden Verweis in den Werken versteht.
Читать дальше