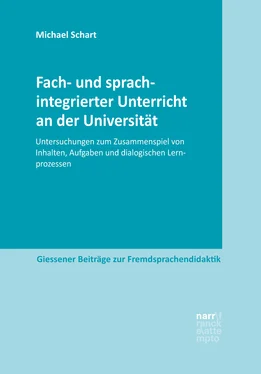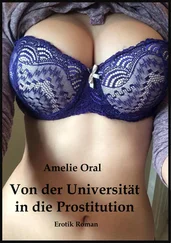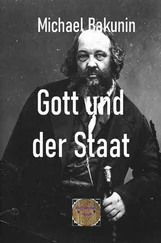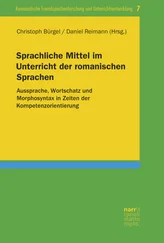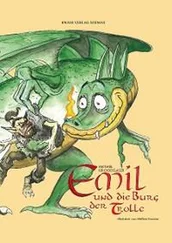Eine weitere Besonderheit der Aktionsforschung liegt darin, dass sie auf langfristige Forschungszyklen setzt. Auch das trifft auf diese Arbeit zu, denn sie ist – wie im Detail noch zu zeigen sein wird – eng verknüpft mit weiteren Studien, die sich demselben Unterrichtskontext widmen. Als im Jahr 2003 mit der empirischen Erforschung des Intensivprogramms für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio begonnen wurde, geschah dies unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit und in der Überzeugung, dass eine kontinuierliche Entwicklung von Curriculum und Unterrichtsgestaltung nur auf dem Fundament evidenzbasierter Entscheidungen möglich sein würde (siehe Kap. 3). Dass dieses Fundament durch unterschiedliche Perspektiven auf das Geschehen und methodische Herangehensweisen an Stabilität gewinnen würde, lag auf der Hand. Und so wurden von Beginn an kleinere Aktionsforschungsprojekte, die ich in einzelnen Lerngruppen durchführte, durch umfassendere Untersuchungen ergänzt, an denen auch andere Forschende teilnahmen.
Auch in der vorliegenden Studie war es daher ein naheliegender Schritt, nach Möglichkeiten zu suchen, weitere interne und externe Kolleginnen und Kollegen in den Forschungsprozess zu integrieren. In diesem Bestreben, verschiedene Sichtweisen einzubinden und das Projekt zugleich in der professionellen Gemeinschaft von Lehrenden zu verankern, spiegeln sich typische Eigenarten von Aktionsforschung. Zugleich führt diese Erweiterung jedoch auch dazu, dass der Charakter der Studie mit dem Begriff der Aktionsforschung nur unzureichend beschrieben werden kann. Da wir uns als Forschungsgruppe verstehen, die neben der kontinuierlichen Programmentwicklung auch einen Beitrag zum Wissensgenese in den Bereichen Deutsch als Fremdsprache bzw. in der Fremdsprachenforschung leisten möchte, weist unser Projekt ebenso einige Gemeinsamkeiten zum Konzept der Entwicklungsorientierten Forschung auf, was ich im Folgenden detaillierter begründen werde.
2.2.4 Entwicklungsorientierte Forschung
Es gibt eine Reihe guter Gründe dafür, weshalb sich die vorliegende Studie neben der Aktionsforschung zugleich auch der Entwicklungsorientierten Forschung1 zugerechnet werden kann. In der Fremdsprachenforschung der letzten Jahre trifft dieser Ansatz auf stetig wachsende Resonanz, was sich meines Erachtens auf die Hoffnung zurückführen lässt, endlich einen Weg gefunden zu haben, die oft beschriebene und viel kritisierte Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. Die Entwicklungsorientierte Forschung verheißt somit dem akademischen Betrieb, seine Legitimation gegenüber der Praxis zu stärken.
Auch die Fachdidaktiken haben diesen Ansatz im Rahmen ihrer Bestrebungen, das forschende Lernen zu fördern, für sich entdeckt (z.B. unter der Bezeichnung „Fachdidaktische Entwicklungsforschung“, Prediger et al. 2012). Er wird als eine effektive Möglichkeit wahrgenommen, um Studierende mit dem Einsatz empirischer Methoden vertraut zu machen, die Herausbildung einer „forschenden Grundhaltung“ bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern zu fördern (Wissenschaftsrat 2001, siehe auch Fichten 2017; Lehmann/Mieg 2018) und nicht zuletzt, um Brücken aus der Welt der Theorie in den unterrichtlichen Alltag zu schlagen (z.B. (Grünewald et al. 2014; Lindner/Mayerhofer 2017). Die wissenschaftlich reflektierte Auseinandersetzung mit dem Design von Praxis wird so zu einem wichtigen Element der Vorbereitung auf die künftige Berufstätigkeit, wodurch sich wiederum die Lehramtsausbildung ihrem Charakter nach anderen Professionswissenschaften wie etwa die Architektur oder der Informatik annähert.
Aus akademischer Perspektive fällt dabei die Abgrenzung zur oben genannten Aktionsforschung leicht. Beide tragen zwar interventionistischen Charakter, aber letztere – so eine verbreitete Sichtweise – werde vornehmlich von Lehrenden selbst betrieben und kümmere sich um die Lösung vermeintlich kleinteiliger praktischer Probleme oder das Verstehen eng begrenzter Situationen (vgl. Bakker 2018:15). Die Entwicklungsorientierte Forschung tritt hingegen mit dem Anspruch auf, pädagogische Innovationen auf der Basis von Theoriewissen zu konzipieren und deren Umsetzung in der Unterrichtspraxis systematisch in einem iterativen Prozess zu untersuchen, um die Ergebnisse dann wieder in die wissenschaftliche Theoriebildung einspeisen zu können.
Ein erstes spezifisches Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung in der Fachdidaktik ergibt sich demnach aus der engen Verknüpfung von theoretischen und unterrichtspraktischen Aspekten. Im Unterschied zum experimentellen Zugang zu Lehr- und Lernprozessen, wie er beispielsweise von der psycholinguistischen Fremdsprachenforschung praktiziert wird, geht es nicht darum, die Faktorenvielfalt des Unterrichtsgeschehens auf laborähnliche Bedingungen zu reduzieren. Vielmehr akzeptiert die Entwicklungsorientierte Forschung die Komplexität gelebter Praxis und versucht, an deren Verbesserung mitzuwirken. Nicht das Überprüfen von Theorien steht im Fokus, sondern das Übersetzen von Theorien in einen konkreten unterrichtlichen Kontext. Als Ergebnis entstehen Ideen für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung unterrichtlicher Arrangements. Sie können zu neuen Materialien ebenso führen wie zu innovativen Lösungen für einzelne Unterrichtsaktivitäten oder komplette Programme. Immer jedoch wird die Intervention holistisch gedacht. Sie ergibt sich erst aus der Abwägung der im betreffenden Praxisumfeld wirkenden Faktoren und Interessen. In diesem Sinne muss sie als ein „Produkt eines Kontextes“ (Reimann 2005:63) gesehen werden. Die Qualität der Entwicklungsorientierten Forschung zeigt sich daher zunächst – und dabei deutliche Parallelen zur Aktionsforschung aufweisend – an der Innovationskraft der eingebrachten Ideen, der Nützlichkeit der Intervention und auch ihrer Nachhaltigkeit (Bakker/van Eerde 2015:6; Reinmann 2005).
Die zentrale Frage bei diesem Forschungsansatz ist somit, ob es den Handelnden tatsächlich gelingt, sich auf die Komplexität eines unterrichtlichen Kontextes einzulassen und erfolgreich Weiterentwicklungen in der Unterrichtspraxis anzustoßen. Dem steht die Gefahr entgegen, die Rolle des Interventionsdesigns überzubetonen, wie Richter/Allert (2017) anmerken. Denn das würde den Forschungsprozesses auf seine technologischen Aspekte verengen. Er empfiehlt daher als naheliegende Maßnahme, die Handelnden in der Praxis möglichst umfassend zu beteiligen, womit er freilich auf eine weitere Verbindungslinie zur Aktionsforschung verweist.
Das zweite spezifische Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung wird darin gesehen, dass die Akteurinnen und Akteure im folgenden Schritt auch die Verantwortung für ihre theoriebasierten Entwürfe übernehmen und der Frage nachgehen, welche Folgen sich aus diesen für den unterrichtlichen Alltag ergeben. Dafür steht ihnen die gesamte Palette der empirischen Verfahren zur Verfügung, denn die Entwicklungsorientierte Forschung versteht sich nicht als eine Forschungsmethode, sondern eher als ein forschungsmethodologischer Rahmen. Es wird ein iterativer Prozess in Gang gesetzt, um die Auswirkungen der Intervention gleichlaufend zu ihrer praktischen Umsetzung zu erfassen und auf der Grundlage datenbasierter Einsichten das Design immer wieder neu anzupassen. Die Unterschiede zur Aktionsforschung ergeben sich dabei wohl vor allem durch die Konsequenz, mit der die Instrumente empirischer Sozialforschung Anwendung finden und sind somit nicht grundsätzlicher, sondern allenfalls gradueller Natur.
Dass die Ergebnisse aus solchen praktischen Problemlösungen dann wiederum – vor allem in Form von Design-Prinzipien – in die Theoriebildung einfließen, macht das dritte spezifische Merkmal der Entwicklungsorientierten Forschung aus.2 Dieser Anspruch erzeugt jedoch ein Spannungsfeld zwischen der bereits genannten praktischen Relevanz als Gütekriterium und jenen Anforderungen, die an die Qualität wissenschaftlicher Theoriebildungsprozesse gestellt werden. Als Lösungsmöglichkeit bietet es sich an, die unterschiedlichen Perspektiven von Forschung und Praxis zum ersten anzuerkennen und zum zweiten zielgerichtet als Quelle für den Erkenntnisgewinn zu nutzen (Brahm/Jenert 2014:50). Mit ihrer Akzentuierung der Genese theoretischen Wissens hebt sich die Entwicklungsorientierte Forschung also zunächst deutlich von der Aktionsforschung ab, um sich ihr jedoch im nächsten Schritt gleich wieder anzunähern.
Читать дальше