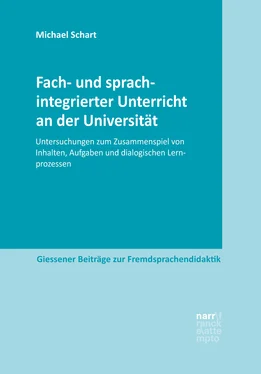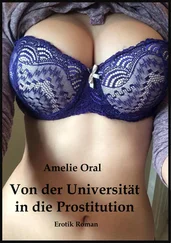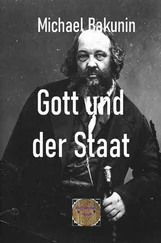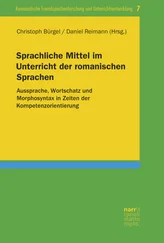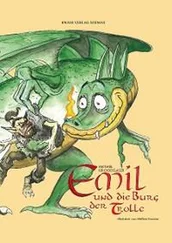Auch wenn sich die Think-Pair-Share-Technik in besonderer Weise anbietet, um das Prinzip der Lücke in einen kohärenten unterrichtlichen Ablauf einzubinden, so lässt sich doch der aufgabenbasierte Ansatz nicht auf eine bestimmte Abfolge methodischer Schritte reduzieren. Über die oben genannten Prinzipen hinaus beschränkt er sich darauf, Hilfestellungen in Form von Aufgabentypologien bereitzustellen. Diese Typologien verdeutlichen die große Bandbreite an Gestaltungsvarianten. Sie schärfen das Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte, die bei der Entscheidung für eine bestimmte Aktivität relevant sind. Sollen sich beispielsweise die Lücken in den gap activities auf Informationen beziehen, auf Meinungen oder auf Argumentationen (Nunan 1987:46ff)? Und welche kognitiven Fähigkeiten werden von einer Aufgabe angesprochen? Geht es eher darum, Informationen nur zu ordnen und aufzulisten, oder können und sollten größere Anforderungen an die Lernenden gestellt werden, etwa indem sie Vergleiche anstellen, Synthesen bilden oder eigenständig Problemlösungen entwickeln (Willis 1996). Die Typologien nutzen auch gerne Dichotomien, um das Spektrum an Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen: So können Aufgaben eher Input-fokussiert angelegt sein oder Output-fokussiert, schriftliche oder mündliche Aktivitäten auslösen, auf konvergente oder divergente Ergebnisse zielen, offen oder geschlossen gestaltet sein, einseitig – etwa im Sinne einer Präsentation – oder zweiseitig, wenn ein Austausch angestrebt wird.
Lehrenden wird somit eine sehr breite und flexibel handhabbare Palette von gestalterischen Optionen geboten, auf deren Grundlage sich ein abwechslungsreiches Unterrichtsgeschehen arrangieren lässt. Aber die Abwechslung allein, so wichtig und motivierend sie für erfolgreiche Lernprozesse auch sein mag, verleiht einem Kursangebot noch keine Stringenz. An dieser Stelle tritt das Kernproblem des aufgabenbasierten Unterrichts zutage (vgl. Nunan 2009:30): Wenn man bewusst auf das Gerüst verzichtet, das grammatische Progressionen bereitstellen, und wenn zugleich die empirische Aufgabenforschung kaum hilfreiche Erkenntnisse für eine systematische Unterrichtsplanung hervorbringt (siehe Kap. 2.5.1), welches Kriterium bleibt Lehrenden und Programmgestaltern dann, um das vielfältige Angebot an Aufgaben zu einem pädagogisch sinnvollen Verlauf anzuordnen?
Die Antwort ist offenkundig und sie kam in der bisherigen Argumentation bereits mehrfach zur Sprache: Soll ein „Schrotflinten-Syllabus“ (van Lier 1996:205), also eine mehr oder weniger beliebige Aneinanderreihung von Impulsen vermieden werden, dann bedarf die Planung aufgabenbasierten Unterrichts eines inhaltlichen Rahmens. Auch sehr kreative und anregende Aufgabenstellungen können zu frustrierenden Aktivitäten führen, wenn sie sich nicht zugleich auf Gegenstände beziehen, die von den Lernenden als interessant, herausfordernd oder motivierend empfunden werden. Fitzsimmons-Doolan et al. (2017:22) weisen daher meines Erachtens zurecht darauf hin, dass Lückenaktivitäten ohne überzeugende thematische Einbettung leicht als gekünstelte oder konstruierte Unternehmung wahrgenommen werden. Wie zutreffend diese Kritik ist, lässt sich am Beispiel der Aufgabensammlung von Ur (2015) illustrieren, in der ansprechende methodische Ideen unter der sie begleitenden inhaltlichen Beliebigkeit leiden.
Es kommt beim aufgabenbasierten Unterricht – ganz anders als es die Bezeichnung suggeriert – demnach keineswegs vor allem auf die Aufgabenstellungen an. Tatsächlich entfaltet sich sein Potenzial erst durch die Komposition von Aufgaben und Inhalten.
Verknüpfung von Aufgaben und Inhalten
Eine der stringentesten Konzepte für eine inhaltsbasierte Anordnung von Aufgaben zu einem Syllabus stammt von Long (2015). Er setzt an einer Bedarfsanalyse an, fragt also zunächst danach, auf welche Situationen in der Arbeits- bzw. Lebenswelt ein Kurs die Teilnehmenden vorbereiten soll. Diese Situationen werden dann in unterrichtliche Aufgaben übersetzt, sodass sich das Geschehen innerhalb des Klassenraums schrittweise jenem außerhalb annähert. Nur auf diese Weise, so Longs Argumentation, sei es überhaupt möglich, einen kohärenten Syllabus aufgabenbasierten Unterrichts zu erstellen. Die traditionelle Unterscheidung zwischen dem Gegenstand eines Unterrichts und der Methode wird somit weitgehend aufgehoben (vgl. auch van den Branden 2006:6).
Longs Vorgehensweise hat zweifellos Charme, denn sie erleichtert es Lehrenden erheblich, die Relevanz des Unterrichts zu verdeutlichen. Wenn beispielsweise die Teilnehmenden an einem fach- und sprachintegrierten Vorbereitungskurs für ausländische Pflegekräfte bereits im Klassenzimmer mit Aufgaben konfrontiert werden, die sich sehr eng an den Anforderungen ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit orientieren, dann ist dieses Vorgehen unmittelbar einsichtig und bedarf keiner weiteren Begründung. Und es finden sich auch im Kontext japanischer Universitäten Versuche, Longs Ideen umzusetzen. So beschreibt Lambert (2010), wie er auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse bei potenziellen künftigen Arbeitgebern seiner Studierenden den Englischunterricht neu konzipiert. Und Iizuka (2019) führt eine Bedarfsanalyse durch, um das bevorstehende Auslandsstudium seiner Lernenden besser vorbereiten zu können. Durch Umfragen und Interviews – beispielsweise mit erfahrenen Gastfamilien – versucht er systematisch die kommunikativen Anforderungen während des Auslandsaufenthaltes zu erfassen, die dann in einem zweiten Schritt in die Planung eines aufgabenbasierten Kurses einfließen.
Wie diese Beispiele verdeutlichen, überzeugt das von Long vertretene Konzept – das er selbst als das einzig sinnvolle betrachtet – durch seine Stringenz. Gleichwohl gehen Longs Überlegungen weit an den unterrichtlichen Bedingungen vorbei, wie sie viele Lehrende in den Bildungssystemen weltweit vorfinden. Zumeist lassen sich die Anforderungen, vor denen die Lernenden in Zukunft stehen werden, nur sehr grob umreißen. Daher gewinnen bei der Programmgestaltung neben den fremdsprachlichen und fachlichen Kompetenzen die generischen Kompetenzen als Bildungsziele eine besondere Bedeutung. Sie werden mit Themen verknüpft, die auf das Interesse der Teilnehmenden stoßen oder – wie im hier untersuchten Fall – sich am Studienfach orientieren. Je nach Kontext können auf diesem Wege sehr unterschiedliche Modelle einer Verknüpfung von Inhalten und Impulsen entstehen. Sie weisen letztlich nicht weniger Kohärenz als der von Long favorisierte Ansatz auf, auch wenn der unmittelbare Zusammenhang mit künftigen Gebrauchssituationen fehlt.
Als ein Beispiel lässt sich Breens (1987) Prozess-Syllabus anführen, der konsequent von den Interessen der Teilnehmenden ausgeht und seine Gestalt erst durch einen gemeinsamen Findungsprozess aller Beteiligten erhält. Wenn institutionelle Bedingungen jedoch diesem sehr offenen Ansatz entgegenstehen, bietet sich ein themenbasierter Syllabus an. Dessen Struktur wird eher von den Entscheidungen der Lehrperson bzw. curricularen Vorgaben geprägt.
Sowohl beim Prozess-Syllabus als auch beim themenbasierten Syllabus kann sich die konkrete inhaltliche Planung an unterschiedlichen Leitgedanken orientieren. So schlägt Cameron (2010) vor, jedes Rahmenthema in die Aspekte Menschen, Objekte, Aktionen, Prozesse, typische Ereignisse und Orte zu untergliedern. Ellis (2003) gruppiert in seinem „Themengenerator“ die Inhalte konzentrisch um das lernende Individuum. Im unmittelbaren Umfeld der Lernenden befinden sich somit die Gegenstände der alltäglichen Lebenswelt, am weitesten entfernt globale Themen und auch die Welt der Imagination. Mit fortschreitender fremdsprachlicher Kompetenz, so die Idee, erschließen sich die Lernenden nach und nach den derart vorgezeichneten Raum.
Diese Vorschläge für die Strukturierung der inhaltlichen Planung richtet sich an Kursangebote, deren Curriculum sich im Unterschied zu Longs Konzept nicht an fest umrissenen, zukünftigen (beruflichen) Anforderungen orientieren kann. Sie sind daher auch für das Intensivprogramm für Deutschlandstudien an der Keio Universität von besonderem Interesse. Wie bereits in Kap. 2.4.4 anklang, inspirierte vor allem der Themengenerator dessen inhaltliches Konzept. So befasst sich der Unterricht im ersten Studienjahr schwerpunktmäßig mit Fragen der Identität und richtet sich in den folgenden Studienjahren auf die Themenbereiche Generation und Gesellschaft. Die Übergänge sind jedoch fließend gestaltet, was sich gerade an den mit dieser Studie untersuchten Unterrichtseinheiten ablesen lässt. Obwohl sich die Lernenden mit einem Gegenstand beschäftigen, der ihre alltägliche Lebenswelt unmittelbar betrifft – die Beziehung zwischen den Menschen und den Dingen, die sie umgeben –, geht es zugleich um gesellschaftspolitische bzw. juristische Fragen (siehe Kap. 2.4.4).
Читать дальше