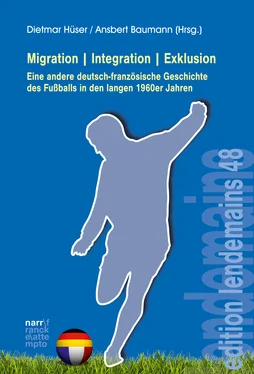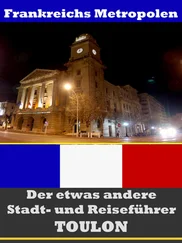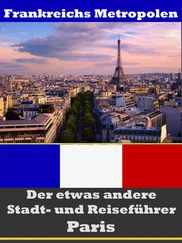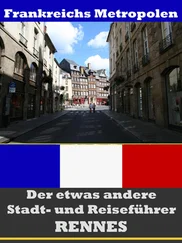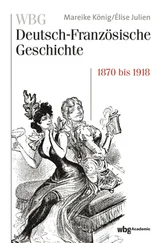Sebastian Braun (Berlin) beschäftigt sich in seinem Beitrag aus sportsoziologischer Warte mit der Relevanz deutscher Sportvereine für Integrationsprozesse von Menschen mit Migrationshintergrund. Nach einführenden Bemerkungen zu den vielen staatlich geförderten und verbandspolitisch umgesetzten Programmen der letzten Jahrzehnte folgen Ausführungen zur Rolle der Vereine. Dabei unterscheidet Braun zwei grundlegende Ebenen: erstens die Binnenintegration innerhalb von Vereinsstrukturen („Integration in den Sport“) und zweitens außenintegrative Effekte der Sportclubs („Integration durch den Sport“). Während Aspekte der Binnenintegration mit Blick auf das Vereinsleben und das damit verknüpfte soziale Miteinander relativ leicht zu greifen seien, lasse sich die externe Wirkung – sprich: das „übersportliche“ Zusammenwachsen von Menschen verschiedener Herkunft durch gezielt öffentlich geförderten Sport als „Gesellschaftskitt“ – weitaus schwieriger messen. Stets zu berücksichtigen seien dabei Faktoren wie soziale Ungleichheit oder auch subtile Schließungsmechanismen formal offener Vereine. Über „ Spill-over -Effekte“, die sich an die Idee von „Integration durch den Sport“ knüpfen und entsprechende Integrationsleistungen auf andere Handlungskontexte wie Schule oder Beruf übertragen sollen, kann deshalb, so Sebastian Braun, bisher nur wenig empirisch Belastbares gesagt werden.
Den Fragen, welche Formen von Integrationsverständnis und Integrationspolitik in Deutschland und in Frankreich vorherrschen und wie ähnlich bzw. wie unterschiedlich die nationalen Fußballverbände – die Fédération Française de Football (FFF) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) – mit Diversität im Spitzen- wie im Amateurfußball umgehen, widmet sich der Beitrag von Pierre Weiss (Luxemburg). Herausgearbeitet wird ein Schema, das sich über mehrere Vergleichsachsen definiert und das für den französischen Fall eine primär räumliche Dimension im Umgang mit Fußballspielenden aus Migrationskontexten hervorhebt, für den deutschen Fall eher eine soziale Dimension, die unmittelbare Maßnahmen im Sinne „kompensatorischer Diskriminierung“ umfasst. Der Artikel setzt sich mit den Vor- und Nachteilen beider Ansätze auseinander, betont aber zugleich, dass letztlich nur dominante Trends zu erfassen sind, die kaum die tatsächliche Komplexität der Gegebenheiten widerspiegeln. Eine Gemeinsamkeit im Vorgehen der Fußballverbände sieht Pierre Weiss in der Grundsatzentscheidung, einen nachdrücklichen Kampf gegen Diskriminierungen zu führen, anstatt eine Politik der Repräsentation ethnischer Gruppen zu betreiben.
Vor dem Hintergrund dominanter Gender-Ansätze im Erforschen des Frauenfußballs macht Camille Martin (Lyon) im abschließenden Aufsatz darauf aufmerksam, dass solche Analysen vielfach von gesellschaftlich und ethnisch homogenen Gruppen ausgehen, ohne die Differenzkategorien soziale Klasse und kulturelle Herkunft mit einzubeziehen. Dabei hat es wegen der relativ geringen Anzahl an Frauenfußballteams eine hohe Wahrscheinlichkeit, sozial wie ethnisch recht gemischte Gruppen vorzufinden, die sich gemeinsam für ein sportliches Ziel einsetzen. Auf der Basis eigener Einsichten, gewonnen aus der Praxis teilnehmender Beobachtung in einem Verein aus dem Großraum Paris, kann Camille Martin komplexe, ambivalente und stark situationsabhängige Verhaltens- und Kommunikationsmuster der Fußballerinen untereinander anschaulich dokumentieren: Je nachdem, ob sich diese sich im Gesamtteam oder in Untergruppen bewegen, können die Diskurse sowohl der „weißen“ als auch der „migrantischen“ Spielerinnen stark variieren: zwischen xenophob angehauchten und anti-rassistischen Konnotationen auf der einen Seite, zwischen national-französischen und herkunftsbezogenen Identifikationen auf der anderen Seite.
Kontexte und Danksagungen
Wie bereits erwähnt gehen die folgenden Artikel bis auf den Beitrag von Camille Martin auf die Saarbrücker Tagung „Migration│Integration│Exklusion – Spannungsfelder einer deutsch-französischen Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Fußballs in den langen 1960er Jahren“ im Juli 2018 zurück. In der Hoffnung, dass das Ergebnis allseits zufrieden stimmt, sei zunächst den Autorinnen und Autoren ganz herzlich gedankt, die vor eineinhalb Jahren den Weg an die Saar gefunden, im Rahmen der Veranstaltung einen Vortrag gehalten und später eine ausgearbeitete schriftliche Version zu Publikationszwecken abgeliefert haben. Weiterer Dank gebührt etlichen anderen Personen, die – wie Franz-Josef Brüggemeier (Freiburg) – zum wissenschaftlichen Gelingen der Tagung durch substanzielle Debattenbeiträge oder Kommentare im Laufe der drei Tage unentbehrlich gewesen sind. Ohne die fachdisziplinäre Expertise und wohlwollende Kritik aus geschichts-, kultur-, medien-, sozial- und sportwissenschaftlichen Blickwinkeln, ohne die Offenheit und Diskussionsfreude wäre das Umsetzen eines primären Tagungszieles kaum gelungen: nämlich das Ausloten von Stichhaltigkeit, Mehrwert und Erkenntnispotenzialen einer migrationshistorisch fokussierten und transnational deutsch-französisch-europäisch angelegten Fußballgeschichte der langen 1960er Jahre, die – wie eingangs gezeigt – weiterhin in den Kinderschuhen steckt.
Veranstaltet hat die Saarbrücker Zusammenkunft der Lehrstuhl für Europäische Zeitgeschichte an der Universität des Saarlandes. Die organisatorische Detailarbeit im Vorfeld wie während der Tagung oblag meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, federführend Melanie Bardian, Ansbert Baumann, Philipp Didion, Saskia Lennartz, Sarah May, Jasmin Nicklas und Martina Saar. Für den stets tatkräftigen, umsichtigen und gut gelaunten Einsatz sei allen Beteiligten an der Organisation ebenso gedankt wie der Universität des Saarlandes für das Überlassen des Graduate Centre auf dem Campus. Neuerlich haben die Räumlichkeiten nicht nur ein konzentriertes Arbeiten ermöglicht, sondern dank des stilvollen Ambientes auch zur überaus angenehmen und anregenden Atmosphäre während der gesamten Veranstaltung beigetragen.
Weiterer Dank gilt all denen, die den vorliegenden Sammelband administrativ, technisch und formal mit auf den Weg gebracht haben. Für die redaktionellen Mühen zeichnete neben den beiden Herausgebern federführend und stets professionell Philipp Didion verantwortlich. Was die Endredaktion sowie das Vereinheitlichen und Korrigieren der Texte – wie auch manche redaktionelle Grundsatzentscheidung – anbelangt, war das ganze Lehrstuhlteam Europäische Zeitgeschichte im Einsatz, ganz zum Schluss allen voran Philipp Didion und Sarah May. Als Sponsoren standen uns das Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes sowie ganz besonders die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Seite. Ohne den finanziellen „Beistand“ durch die DFG hätte weder die Tagung stattfinden noch der Sammelband in dieser Form publiziert werden können. Auch dafür ein herzliches Dankeschön.
Alkenmeyer, Thomas, Sport und Alltagskultur in der Nachkriegszeit, in: Deutscher Sportbund (Hg.), Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes. Wege aus der Not zur Einheit, Bd. 2, Schorndorf (Hofmann-Verlag) 1991, S. 157–165.
Amar, Marianne / Poinsot, Marie / Wihtol de Wenden, Catherine (Hg.), A chacun ses étrangers? France – Allemagne de 1871 à aujourd'hui, Paris (Actes Sud / CNHI) 2009.
Archambault, Fabien / Beaud, Stéphane / Gasparini, William (Hg.), Le football des nations. Des terrains de jeu aux communautés imaginées, Paris (Editions de la Sorbonne) 2016.
Asfur, Anke / Osses, Dietmar (Hg.), Neapel – Bochum – Rimini. Arbeiten in Deutschland. Urlaub in Italien, Essen (Klartext) 2003.
Bade, Klaus J., Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München (Beck) 22002.
Читать дальше