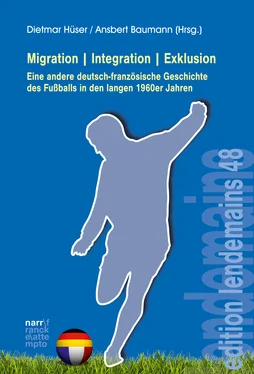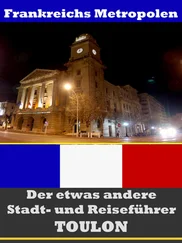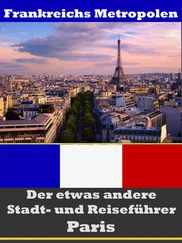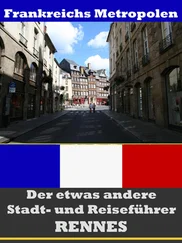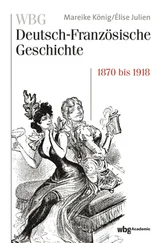Was die positiven Trends vermehrten zeithistorischen Interesses für Fußball und Migration angeht, so sind zumindest drei Spezifika hervorzuheben, die den deutsch-französischen Fokus auf fußballspielende Arbeitsmigranten der langen 1960er Jahre im vorliegenden Sammelband als ganz besonderes Desiderat erscheinen lassen. Erstens meint Fußball und Migration in der Zeitgeschichte fast durchgängig Profifußball und Migration. In beiden Ländern – wie auch europäisch dimensioniert73 – geht es um Spitzensport und Spieler- bzw. Trainertransfers über nationale oder kontinentale Grenzen hinweg,74 wobei professionellen Fußballmigranten aus den früheren Kolonialgebieten spezielle Aufmerksamkeit gewidmet wird.75 Der gesamte Bereich des Breitensports und damit das Gros der Eingewanderten, die zu Tausenden freizeitlich Fußball oder andere Sportarten in unterschiedlichsten Konstellationen praktizierten, bleiben in der Regel außen vor.76
Zweitens behandeln die meisten historischen Analysen zu Fußball und Migration andere Phasen als die langen 1960er Jahre und andere Gruppen als die süd- und südosteuropäischen Migranten, die damals in nördlicher gelegenen Regionen Europas die Arbeitsmärkte unterfütterten. Einen offensichtlichen Schwerpunkt der Forschung bildet schon länger die erste Nachweltkriegszeit: nicht zuletzt, um zu verdeutlichen, dass es sich bei fußballerischer Migration weder um ein rezentes Phänomen und einen linearen Prozess handelt, dass die frühen kontinentaleuropäischen Vereine im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts überaus kosmopolitisch angehaucht waren und dass die Nationalisierungstrends vor und nach 1918 fortwährenden Transferpraktiken dem mehr und mehr boomenden Fußballgeschäft keinen Abbruch taten.77 Im deutschen Fall konzentrieren sich die Untersuchungen vor 1945 zudem auf bestimmte Zuwanderer in bestimmten Räumen, allen voran auf die masurenstämmigen Fußballer im Ruhrgebiet und beim FC Schalke 04 ,78 die vornehmlich in den drei Jahrzehnten nach 1880 aus dem südlichen Ostpreußen ins Revier gekommen waren, um in der florierenden Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau zu arbeiten.79 Deren „emotionale Seßhaftwerdung in der neuen Heimat“80 lässt sich freilich kaum allein über die Schalker Erfolge seit Mitte der 1920er Jahre erklären.
Drittens vollzieht sich Sport- und Fußball- wie auch Migrationsgeschichtsschreibung weiterhin primär unter nationalen Auspizien. Zwar sind beachtliche Fortschritte transnational dimensionierter Ansätze offensichtlich, die breite Mehrheit der Studien, die Fußball und Migration zusammendenken, bewegt sich freilich nicht in solchen „Mesoräumen“81. Eher schon thematisiert werden die Verhältnisse in den Aufnahmegesellschaften, die sich angesichts spezifischer Traditionen und Selbstbilder, Rahmungen und Praktiken unterschiedlich ausprägen können und eher in körperlich und sinnlich erfahrbaren „Makro-“ bzw. „Mikroräumen“ alltäglicher Lebenszusammenhänge zu greifen und analysieren sind.82
Kurzum: Trotz des mehr als offensichtlichen Erkenntnispotenzials bilden Abhandlungen über migrantischen Sport und Fußball der langen 1960er Jahre bislang keinen Schwerpunkt der zeithistorischen Forschung, erst recht nicht unter deutsch-französischen oder europäischen Vergleichsgesichtspunkten.83 Gerade in dieser Perspektive sollen und wollen deshalb die folgenden Beiträge die hohe Relevanz einschlägiger Untersuchungen darlegen, zentrale Leitfragen formulieren und die wenigen bisherigen Erkenntnisse knapp umreißen, um damit erste Pflöcke einzuschlagen in ein transnationales Themenfeld mit Zukunft.
Sammelband, Kapitel und Beiträge
Auf den noch immer gültigen Tatbestand kaum existierender zeithistorischer Forschungen über fußballerische Aktivitäten von süd- und südosteuropäischen Arbeitsmigranten der langen 1960er Jahre in transnationaler deutsch-französischer Perspektive geht ein laufendes Saarbrücker DFG-Postdoc-Projekt zurück;1 ebenso die internationale wie interdisziplinäre Tagung „Migration│Integration│Exklusion – Spannungsfelder einer deutsch-französischen Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Fußballs in den langen 1960er Jahren“, die vom 4. bis zum 6. Juli 2018 im Graduate Centre der Universität des Saarlandes stattgefunden und als Grundlage der vorliegenden Aufsatzsammlung gedient hat.2
Ziel war es, die aktuellen öffentlichen und fußballinternen Debatten zu Fußball und Migration zu historisieren, um auf der Folie gesellschafts- und kulturgeschichtlicher Rahmungen strukturelle Integrationspotentiale und Exklusionsrisiken fußballerischer Praktiken im Amateur- wie Profi-Bereich für die langen 1960er Jahre herauszuarbeiten. Die schriftlichen Fassungen der damaligen Vorträge – ergänzt um einen zusätzlichen einschlägigen Artikel – haben Eingang in die vorliegende Aufsatzsammlung gefunden und sind auf drei Kapitel verteilt. Die ersten beiden Kapitel konzentrieren sich weitgehend auf die langen 1960er Jahre und beleuchten den Kernzeitraum des Bandes zunächst unter deutsch-französischen Vergleichsprämissen, dann eher als Einzelländeranalysen zu Westdeutschland, Luxemburg und Österreich; das dritte Kapitel greift Fußball und Migration aktualitätsorientierter, vornehmlich aus sozialwissenschaftlicher Sicht auf und legt den räumlichen Fokus wieder primär auf den deutschen bzw. französischen Fall.
Fußball & Migration zeithistorisch I – Deutsch-französische Blicke
Im ersten zeitgeschichtlich dimensionierten Kapitel „Deutsch-französische Blicke“ unterstreicht Dietmar Hüser (Saarbrücken) noch einmal den Mangel an transnationalen empirischen Studien zur Rolle freizeitkultureller und fußballerischer Betätigung für die Integration von Arbeitsmigranten im Frankreich und Westdeutschland der langen 1960er Jahre. Aus den jeweils nationalen fußball- und migrationshistorischen Forschungsansätzen, die überhaupt zur Thematik vorliegen, filtert der Artikel erste Erkenntnisse heraus und rückt diese in eine vergleichsgeschichtliche Perspektive. Dabei zeigen sich bereits deutlich mehr deutsch-französische Ähnlichkeiten in den Chancen und Schranken, die migrantisches Fußballspielen und Vereinsleben vor Ort für mögliche Integrationsprozesse mit sich brachte, als dies Divergenzen in respektiven Einwanderungstraditionen, Gelegenheitsstrukturen und politisch-kulturellen Kontexten suggerieren. Anders als Politik- und Verbandskreise gern verlauten lassen war Integration durch Sport in beiden Ländern ein komplexer, ein vielfach indirekter – und weniger durch die Praktiken als solche angeregter – Prozess, den ein meist vorübergehendes Spielen in „Migrantenclubs“ weniger behindert als befördert hat und dessen Verlauf stark von den mehrheitsgesellschaftlichen Kontexten abhingen.
Mit der Gründungsgeschichte bürgerlicher Fußballvereine und dem Inszenierungspotential des Ballsports im saarländisch-lothringischen Grenzgebiet vor und nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt sich Bernd Reichelt (Ulm) in seinem Beitrag. Schon damals hat sich Reichelt zufolge der Fußball auf die Gesamtgesellschaft ausgewirkt und – statt integrativ zu wirken – bestehende Spaltungen tendenziell verfestigt: Einerseits hat der Wechsel des territorialen Status und der nationalstaatlichen Zugehörigkeit in den Grenzregionen auch die etablierten fußballerischen Strukturen radikal in Frage gestellt, andererseits blieb die transnationale Kontaktpflege ganz eng an die politischen Konjunkturen zwischen Paris und Berlin geknüpft. Gezeigt wird, wie das Auf und Ab im Spielverkehr von saarländischen und französischen Teams in den 1920er und frühen 1930er Jahren auch eine Chiffre für die deutsch-französischen Beziehungen auf diplomatischer Ebene bildete.
Ebenfalls auf der regionalen Ebene, anhand eines Vergleichs zwischen dem Ruhrgebiet und dem nordfranzösischen Kohlerevier untersucht Diethelm Blecking (Freiburg) in seinem Artikel transnationale Zusammenhänge von Fußball und Migration. Er zeigt auf, dass sich in beiden Ländern die gleiche – wenn auch zeitversetzte – Entwicklung vollzogen hat, zu deren Beginn Fußball erst als Vehikel ethnischer Abgrenzung diente und Integration in die Mehrheitsgesellschaft eher hemmte als förderte. Hier wie dort waren dann für die späteren Integrationsprozesse der „Migrantenkinder“ nicht Faktoren wie nationale Herkunft oder religiöse Zugehörigkeit bestimmend gewesen, sondern die spezifischen sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, die vielfach eine weitgehende Assimilierung generiert haben: bis hin zu Namensänderungen wie etwa bei Raymond Kopa(szewski), der von 1957 bis 1959 mit Real Madrid dreimal den Europapokal der Landesmeister gewann und 1958 den ballon d'or als bester Fußballer Europas erhielt.
Читать дальше