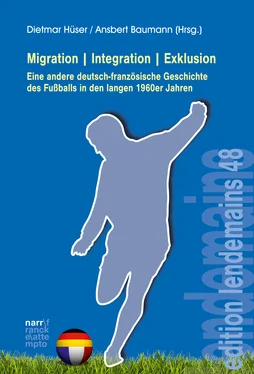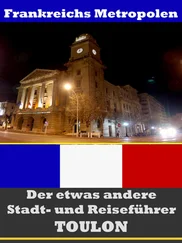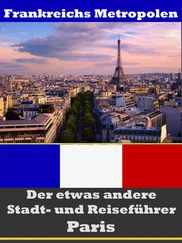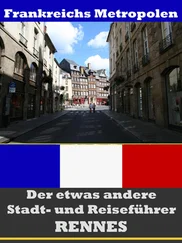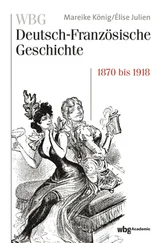Zur Geschichte von Fußball und Migration
Ein Zusammendenken der Bereiche Fußball und Migration fördert weitere historiographische Ähnlichkeiten wie auch etliche Abweichungen zwischen Deutschland und Frankreich zutage. Grundsätzlich unterstreicht ein Blick in Handbücher beider wie auch anderer Länder, dass Migrations- und Fußballgeschichte eher selten wechselseitig aufeinander bezogen sind und das wissenschaftliche Erkenntnispotenzial, das einem engeren Koppeln der Themenfelder innewohnt, vielfach übersehen wird.44 Selbst migrationshistorische Synthesen jüngeren Datums, die doch Einsichten in diachrone und synchrone Zusammenhänge generieren sollen, lassen kaum einmal Raum für freizeitliche, sportliche und fußballerische Aktivitäten von Eingewanderten in den Aufnahmeräumen. Dies gilt für länderübergreifende Überblickswerke – auch für Aufsatzsammlungen – im europäischen wie weltweiten Maßstab,45 aber auch für Darstellungen der letzten Jahre, die sich mit Immigration und Integration vornehmlich aus einer nationalen, deutschen oder französischen Perspektive beschäftigen.46 Das über 460 Seiten umfassende „Lexikon der Einwanderung in Frankreich“ kennt keinen Eintrag „Sport“ oder „Fußball“.47 Ganz ähnlich stellt sich die Situation in quellengesättigten migrationshistorischen Qualifikationsarbeiten dar, die das Freizeitverhalten von Arbeitsmigranten verglichen mit den Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz oder mit der Wohnsituation bestenfalls marginal und konkrete sportliche Aktivitäten überhaupt nicht betrachten.48 Wiederum ergibt sich ein vergleichbarer Befund bei entsprechenden französischen Untersuchungen; Ausnahmen bestätigen die Regel.49
Was die sporthistorische Seite der Medaille anbelangt, so lässt sich kein einheitliches Bild zeichnen. Einerseits sind überblicksartige Handbücher und Sammelbände in Deutschland wie in Frankreich zumeist wenig migrationsorientiert.50 Ähnliches gilt es für breiter angelegte populärwissenschaftliche Bücher zur Sport- und Fußballgeschichte zu vermelden.51 Ebenfalls in dieselbe Richtung weisen einschlägige Veröffentlichungen der nationalen Fußballverbände anlässlich anstehender Jubiläen: Aktive aus Migrationskontexten spielen darin weder im Spitzensport noch im Breitensport eine Rolle.52 Und selbst der lesenswerten FIFA-Festschrift, publiziert zum 100-jährigen Bestehen der Organisation und verfasst von vier ausgewiesenen Fachhistorikern, für die der Weltfußballverband erstmals die sonst verschlossenen Tore seiner Archive geöffnet hatte, fehlt ein eigenes Kapitel zum Thema Fußball und Migration: Es wird lediglich gestreift in den Passagen zu internationalen Spielertransfers und fußballerischer Entwicklungspolitik der FIFA;53 auf einen systematischen Zugriff, um Verbindungen und Kausalitäten aufzuzeigen, wird freilich verzichtet. Andererseits liegen durchaus Synthesen vor, die einen solchen Zugriff für wichtig genug halten, um daraus innerhalb einer fußballhistorischen Gesamtdarstellung einen roten Faden neben anderen zu spinnen.54 Allemal befindet sich aktuell mehr Migration in der zeithistorischen Sportforschung als Sport in der Migrationsforschung. Dies allerdings – wie ein abschließender Blick auf Publikationen offenbart, die von vornherein die Dialektik von Fußball und Migration fokussieren – mit gewissen deutsch-französischen Asymmetrien und Ungleichzeitigkeiten.
Zwar wird seit Jahren auch in der deutschen Zeitgeschichte dazu geforscht,55 deutlich länger allerdings werden in Frankreich die Wechselwirkungen von Sport und Migration breiter thematisiert,56 angeregt nicht zuletzt durch die zeitlich wesentlich früher einsetzende und quantitativ deutlich höhere Präsenz von Fußballspielern mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen des dortigen Spielbetriebs wie auch im früher etablierten Profibereich.57 Der Hype um den WM-Sieg 1998 und seine – auch in Deutschland58 – dominante Interpretation als Erfolg einer „ France au pluriel “ taten ein Übriges, um die Dynamik zu verstärken.59 „Frankreich im Plural“: Das meinte die kreativ-konstruktive Zusammenarbeit von Nationalspielern, deren Namen und Geburtsorte sich fast ausnahmslos wie Familienbücher regionaler oder ethnischer Minderheiten aus Migrationskontexten lasen. Selbst die krachenden fußballerischen Bruchlandungen bei der Folge-WM 2002 in Südkorea und Japan bzw. der WM 2010 in Südafrika, die in manchen öffentlichen Debatten die multikulturellen Heroen der Vorjahre zu „Verrätern an der nationalen Sache“60 degradierte, vermochte es nicht, den Trend zeithistorischer Debatten über Profisport als „ reflet des vagues migratoires “61 wieder zu bremsen. Auch für den Amateurfußball lässt sich neuerdings auf einige fallstudienartige, häufig regionalhistorisch dimensionierte Beiträge in Sammelbänden zurückgreifen, die zumeist die Selbstsicht italienischer, spanischer, portugiesischer, algerischer, marokkanischer oder anderer nationaler Migrantengruppen in der französischen Aufnahmegesellschaft und Breitensportwelt widerspiegeln;62 vielfach beruhen solche Artikel auf voluminösen, häufig geschichts- oder sportwissenschaftlichen Dissertationen, die teils veröffentlicht,63 teils wegen fehlender Publikationspflicht in Frankreich nur schwer zugänglich sind.64
Zudem schlägt sich dort der Nexus von Fußball und Migration dank seiner zentralstaatlich-musealen Verankerung durch die Cité nationale de l'histoire de l'immigration , seit 2012 Musée de l'histoire de l'immigration , in entsprechenden Ausstellungen wie „ Allez la France! – Football et immigration “ nieder.65 Auf deutscher Seite dagegen fanden bislang migrationsbezogene Aspekte selbst bei publikumsträchtigen Museumsevents zur Geschichte des Fußballsports oder der Fußballweltmeisterschaften kaum einmal Berücksichtigung.66 Ausnahmen bildeten die Landesausstellung in Stuttgart vom Sommer 2010, in der zumindest ein Exponat die fußballerischen Aktivitäten der „Gastarbeiter“ dokumentiert hat, sowie zuletzt die Ausstellung zur Geschichte von Fußball und Migration im Ruhrgebiet am Standort der Bochumer Zeche Hannover des LWL-Industriemuseums. Dort ließ sich 2015 auch der 1966 von der Landesregierung gestiftete „NRW-Pokal für Gastarbeitermannschaften“ bewundern, den 1970 die Spieler des griechischen FC Fortuna Dortmund im Schwelgernstadion im Duisburger Stadtteil Marxloh errungen hatten.67 Unterschiede zeigen sich nicht allein in Katalogen zur Fußball-, sondern auch zur Migrationsgeschichte: Während in Begleitbänden zu „Gastarbeitern“ Fußballmaterien selbst in den Passagen ausgespart bleiben, in denen es um Lebensalltag und Freizeitverhalten geht,68 gehören Rubriken zu Sport und Migration – ebenso wie zu diversen populären Künsten aus Migrationskontexten – auf französischer Seite schon länger zum Standardrepertoire entsprechender Publikationen.69
Zeithistorisches Zwischenfazit
Bilanzierend lässt sich nicht nur für die internationale, sondern auch für die deutsch-französische Forschungslandschaft zu Sport bzw. Fußball und Migration festhalten, dass zum einen seit etlichen Jahren „ promising signs of a rise of interest in the topic “ aufscheinen und dass zum anderen – in der Summe – „ historians have contributed relatively little to the considerable scholarship that now exists on the migration of footballers “.70 Tatsächlich nimmt sich der historiographische Output verglichen mit Publikationen aktualitätsorientierter Disziplinen eher bescheiden aus. Beispielsweise setzen sich nunmehr diverse Beiträge mit den jüngeren Entwicklungen im Bereich ethnischer Sport- und Fußballvereine auseinander, und dies in Deutschland wie in Frankreich.71 Insgesamt sind in den vergangenen Jahren unter nationalen Vorzeichen zahlreiche sozialwissenschaftliche Untersuchungen und Sammelbände zu Fußball und Migration erschienen, ebenso Beiträge unter europäischen und deutsch-französischen Prämissen, die zuletzt verstärkt nach den Konsequenzen grenzüberschreitender fußballerischer Wanderungsprozesse für die Europäische Integration und eine „Europäisierung Europas“ gefragt haben.72
Читать дальше