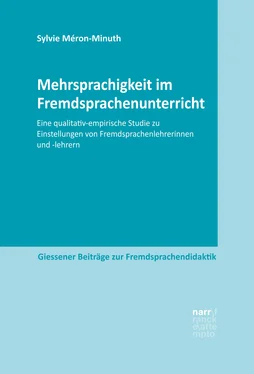Sylvie Méron-Minuth - Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
Здесь есть возможность читать онлайн «Sylvie Méron-Minuth - Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Jedoch entsprechen die Migrantensprachen meistens nicht dem offiziellen, schulischen Sprachenkanon, werden gesellschaftlich nicht besonders wertgeschätzt und folglich in der Schule auch nicht eingebunden (vgl. Fürstenau et al. 2017: 49). Und Adelheid Hu (2010) konstatiert:
„Während für die Schüler/innen Mehrsprachigkeit und sprachlich-kulturelle Identität zentrale Kategorien darstellten, spielten diese für die Fremdsprachenlehrer/innen kaum eine Rolle.“ (Hu 2010: 67)
Brigitte Jostes weist zu Recht kritisch darauf hin, dass die sprachenpolitischen Vorgaben der verschiedenen europäischen Institutionen, die sie mit dem Globalziel „effektive Kommunikation“ (Jostes 2005: 28) bezeichnet, bei der entscheidenden Frage nach den Kriterien im Repertoire der sprachlichen Fähigkeiten unentschieden bleiben und die Globalziele auf personale Kompetenzen abzielen, bzw. den kommunikativen Verwertungsaspekt zu sehr in den Mittelpunkt stellen.
„Mit „effektiver Kommunikation“ als einzigem Ziel jeglichen Sprachenlernens – und so hat es den Anschein, Begründung des menschlichen Sprachbesitzes schlechthin – kommt erstens bei dieser „Komplementarität, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Sprachen“ eine „affektive, identifikatorische, sozialisierende und enkulturierende Rolle einer oder mehrerer Muttersprachen“ überhaupt nicht in den Blick. Aus dem Blick gerät zweitens der andere Sprachgebrauch, der nicht auf „effektive Kommunikation“ abzielt und den Humboldt als den „rednerischen“ bezeichnet. Erst dieser Sprachgebrauch, in dem die Sprache „als Sprache“ erscheint, liefert doch dem Leitbild der Mehrsprachigkeit seinen zugrundeliegenden Begründungszusammenhang.“ (Jostes 2005: 28f.; Hervorhebungen im Text)
Diese Kritik verweist auf die Bemerkungen von Jürgen Trabant, der anmahnt:
„Ich meine damit, […] daß man fremde Sprachen nicht nur zum effektiven Kommunizieren lernt – das machen wir ja schon mit dem Englischen –, sondern daß man sich eine andere europäische Sprache wirklich als einen Kulturgegenstand zu eigen macht, daß man eine fremde Sprache als einen Bildungsgegenstand erwirbt.“ (Trabant 2005: 103)
Trabant ist weiterhin als kritische Stimme zu lesen, wenn er 2001 am Beispiel der Wissenschaftssprachen und der Wissensgesellschaft das Funktionieren und die Umsetzbarkeit der genannten europäischen Ziele vor dem Hintergrund ökonomischer Zwänge in Zweifel zog und erklärte:
„Daher sollten gerade wir Geistes- oder Kulturwissenschaftler bei der Redeweise von der Wissensgesellschaft genau hinhören. Wir können ja nicht umhin zu bemerken, wie unser Wissen, das Wissen von nahen und fernen Kulturen, Kunstwerken, Texten, vergangenen Zeiten und von Sprachen, zunehmend und rasant gesellschaftlich entwertet wird. Die Funktion des von uns produzierten Wissens ist ins Gerede gekommen. Sie wird deswegen diskutiert, weil die schönen Zeiten vorbei sind, in denen die Produktion des Wissens überhaupt – egal wovon – als kostbar angesehen wurde und von der Gesellschaft auch bezahlt wurde. Nun aber drängen die ökonomischen Zwänge – es sind eher vermeintliche Zwänge, shareholder-Zwänge eben – uns die Diskussion um die Legitimation unseres Wissens auf. Wir müssen uns vor dem Tribunal der zukünftigen Wissensgesellschaft verantworten: Nicht jedes Wissen ist da mehr willkommen und folglich finanzierbar, sondern offensichtlich nur noch solches, das der unmittelbaren Reproduktion des geld-generierenden Wissens dient. Warum sollte da z.B. – um ein Beispiel fernerliegenden Sprachwissens zu geben – einer Lateinisch oder Nahuatl studieren? Wie schnell sind dann auch das Erlernen des Französischen und das Studium der französischen Literatur und Sprache kaum mehr zu rechtfertigen.“ (Trabant 2001: 59)
Mit diesem kurzen historischen Abriss lässt sich bereits zeigen, dass eine Erziehung zur Mehrsprachigkeit in Europa – politisch und sprachenpolitisch gesehen – am Ende des 20. Jahrhunderts an zentraler Bedeutung gewonnen hat und politisch gewollt ist, dass aber die Umsetzung dieser politischen Vorgaben keineswegs einfach zu realisieren ist und mit gesellschaftlichen Widerständen zu kämpfen hat.
2.2 Zweisprachigkeit – Mehrsprachigkeit: Annäherung an eine Begrifflichkeit
Als eine Folge zunehmender gesellschaftlicher Globalisierungsprozesse haben Zwei- und Mehrsprachigkeit in den letzten Jahrzehnten den genannten Bedeutungszuwachs erfahren. Durch die Integrationsprozesse in der Europäischen Union werden mehrsprachige Kompetenzen auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger der europäischen Länder erforderlich, wenn sie, im weitesten Wortsinn, geschäftlich miteinander in Beziehungen treten. Selbst wenn die Rolle des Englischen als Lingua franca für die Verständigung zwischen den Menschen nicht in Frage zu stellen ist, zielen die Vorstellung einer europäischen Mehrsprachigkeit mit ihrem zusätzlichen kommunikativen Wert weit darüber hinaus. Auch die Förderung von Regional- und Minderheitensprachen rückte in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Europäischen Union. Mit Sprach-Schutz-Programmen wird versucht, bisher an den Randgedrängte, unterdrückte oder im Niedergang befindliche Sprachen zu revitalisieren.
Zur Diskussion um die Rolle des Englischen kritisiert der Romanist und Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant dies als eine Scheindiskussion:
„Die Frage tut so, als ob sie noch offen wäre. Die Frage ist natürlich längst beantwortet. Welche Sprache für Europa? Natürlich Englisch, globales Englisch, die Sprache der Welt oder, wie ich es nenne, Globalesisch. Globalesisch ist trotz aller französischen Eindämmungsversuche die Sprache der EU, zunehmend auch in den Korridoren und Büros in Brüssel und Straßburg.“ (Trabant 2005: 91)
Er charakterisiert ein so verstandenes, effektives Geschäftsenglisch als „Sprachenkiller“, weil es als internationale Kommunikationssprache die anderen Sprachen in ihrem Inneren bedrohe (vgl. Trabant 2005: 93). Auch könnten Menschen keine engere geistige und emotionale Bindung und Beziehung zu einer reinen Verkehrssprache aufbauen. Dieser Vorstellung stellt er das Modell der drei Sprachen gegenüber, unter denen er die Muttersprache für die jeweils eigene Identität, die praktische, internationale Kommunikationssprache und schließlich die weitere Sprache zum Verstehen des europäischen Anderen subsumiert.
Entgegen ersten Vorstellungen einer Lingua franca hat die Europäische Union sich auch zum Ziel gesetzt, die Mehrsprachigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu fördern (Muttersprache + 2) und möglichst früh mit einer gezielten Fremdsprachenförderung zu beginnen (vgl. Hufeisen 1998), denn das Phänomen europäischer Mehrsprachigkeit wird längst als der Regel- bzw. Normalfall im 21. Jahrhundert angesehen, während Zweisprachigkeit eher als Sonderfall der Mehrsprachigkeit verstanden wird (vgl. Trim; North & Coste 2001: 17 und Lutjeharms 2009: 19).
Um die Möglichkeiten zur Erfüllung dieses Ziels zu untersuchen, gilt es im Folgenden zunächst zu klären, was unter jenen Begriffen der Zwei- und Mehrsprachigkeit zu verstehen ist, und in welchen Formen sie sich hier äußern.
Es mag auf den ersten Blick einfach erscheinen: Mehrsprachigkeit heißt, mehrere Sprachen zu beherrschen. Doch schon eine solche – sehr einfach formulierte – Erklärung ist problematisch und keinesfalls so klar, wie sie auf den ersten Blick scheint. Denn Mehrsprachigkeit, so machen etliche Forscher deutlich, ist beileibe kein klares Konzept und es gibt zahlreiche, unterschiedliche Kategorisierungen dieses Konzept (vgl. u.a. Bertrand & Christ, 1990; Meißner, 1993; de Cillia 2010; Bär, 2004; Boeckmann et alii 2012: 79).
So weist exemplarisch eine Reihe von Forscherinnen und Forschern (z.B. Beacco & Byram 2007: 17; Riehl 2009; Hu 2011; Boeckmann et alii 2012) auf die im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (Europarat 2001) vorgenommene Unterscheidung von Plurilingualismus (individuelle, persönliche Mehrsprachigkeit) und Mehrsprachigkeit / Vielsprachigkeit (gesellschaftliche Mehrsprachigkeit) hin. Diese begriffliche Unterscheidung wird allerdings in den meisten Beiträgen nicht übernommen1; vielmehr geht es hauptsächlich um die persönliche Mehrsprachigkeit, die immer in gesellschaftlich mehrsprachigen Kontexten entwickelt bzw. gefördert werden soll. Doch auch die persönliche Mehrsprachigkeit lässt sich nicht ohne Weiteres konzeptuell erfassen. So widmet sich die Forschung einerseits der so genannten "lebensweltlichen Mehrsprachigkeit" und Fragen zur damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Multikulturalität bzw. zur Mehrsprachigkeit in Migrationsgesellschaften (Hu 2003; Krumm 1994; Gogolin 2001; Fürstenau 2011; Lengyel 2017). Weitere Forscherinnen und Forscher (z.B. Hu 2004; Mordellet-Roggenbuck 2009; Jakisch 2014, 2015; Heydt & Schädlich 2015) beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit dem schulischen bzw. institutionellen Fremdsprachenlernen, das zur individuellen Mehrsprachigkeit führen soll.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mehrsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.