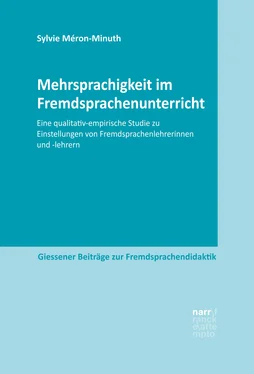« Le plurilinguisme en tant que valeur et finalité des politiques linguistiques et européennes est considéré comme un instrument de cohésion sociale. » (Crochot 2006: 28)
Mit den Interviews soll versucht werden, die Lehrenden zu motivieren, über ihre Einstellungen zur Mehrsprachigkeit, Position zu beziehen. In der Analyse ihrer Stellungnahmen wird auch zu zeigen sein, welche Aspekte hier im Vordergrund stehen und ob es sich eher um homogene Vorstellungen handelt oder ob vielmehr, vor dem Hintergrund einer heterogenen Praxis, differenzierte Sichtweisen vorherrschen. Auch wird zu zeigen versucht werden, inwieweit ihre Einstellungen – bewusst oder unbewusst – mit den Leitgedanken der europäischen Sprachenpolitik übereinstimmen bzw. differieren. Es gilt als Folge dessen zu ermitteln, was unterrichtende Lehrkräfte über ihren beruflichen Alltag und den Umgang mit Mehrsprachigkeit berichten, inwieweit sie diese – den eigenen Berichten nach – praktizieren oder auch nicht, und warum sie in der einen oder anderen Weise handeln.
Es geht auch um die verstehende Deutung und Ursächlichkeit von Einstellungen und sozialem Handeln von Fremdsprachenlehrkräften als Experten (vgl. Gläser & Laudel 2010: 25). Die wissenssoziologische Diskussion über den Expertenbegriff (vgl. Bogner; Littig & Menz 2014: 9f.) soll hier nicht weiter fortgeführt werden. Nur soviel: Fremdsprachenlehrkräfte sind im Gegensatz zu den Politikern, die beispielsweise das hier interessierende europapolitische Postulat „Mehrsprachigkeit“ aufgestellt haben, Experten in der unterrichtlichen Umsetzung beziehungsweise Nichtumsetzung eben jener politischen Forderung und vieler anderer von außen an sie herangetragener Begehrlichkeiten. Ihr Expertenwissen ist gepaart mit den oben genannten Einstellungen und subjektiven Theorien und basiert auf ihrer unterrichtlichen Praxis. Gemäß der wissenssoziologischen Definition sind Experten Personen, die sich
„[…] ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.“ (Bogner; Littig & Menz 2014: 13)
Diese relativ verengte Definition, die sich von einer Vorstellung kritisch absetzen will, wie „Alle Menschen sind Experten“ (Bogner; Littig & Menz 2014: 10), vernachlässigt den bereits genannten Aspekt der Einstellungen und subjektiven Theorien. Lehrkräfte sind Experten für pädagogisches Handeln und die Aktionsforschung (vgl. u.a. Moser 1977; Fiedler & Hörmann 1978; Minuth 2008) zeigt Wege zur Beforschung dieses unterrichtlichen Handelns durch die Lehrperson selbst. Ihre Expertise haben sie in der universitären Ausbildung und im Referendariat erworben und diese gleicht sich unablässig mit der täglichen Praxis und den ursprünglichen eigenen Erfahrungen ab.
Allerdings trifft die oben genannte Vermittlungsdimension – die „Macht der Experten“ (Bogner; Littig & Menz 2014: 14) – gegenüber anderen Akteuren nur dann zu, wenn die Experten selbst in ausbildender Funktion tätig sind. Dies ist aber auch immer dann der Fall, wenn die hier befragten Lehrpersonen Mentorentätigkeiten oder Aufgaben in der Referendarausbildung übernehmen, und damit auch ihre eigenen Einstellungen und subjektiven Theorien weitergeben1.
In jedem Fall ist das hier gemeinte Expertenwissen als Deutungswissen zu interpretieren und damit gilt es, die implizierten Handlungsorientierungen und Normen in deren Aussagen zu rekonstruieren und zu dekodieren. Im Sinne der rekonstruktiven Sozialforschung (vgl. Bohnsack 2007, 2014) gilt daher:
„Die Realität ist nicht einfach eine Ansammlung von Dingen und Relationen, sprich: von „einfach“ vorliegenden Fakten, die durch die Forschung möglichst wirklichkeitsgetreu und verzerrungsfrei abgebildet werden kann und soll. Die Wirklichkeit ist vielmehr ein Resultat vielfältiger Aushandlungsprozesse über die Bedeutung der Dinge, kurz gesagt: eine Interpretationsleistung der Subjekte bzw. deren Konstruktion. […] Wenn man also davon ausgeht, dass soziales Handeln im Wesentlichen durch jene (oft gar nicht bewussten) Werte und Maximen strukturiert ist, die den konkreten Dingen und Prozessen überhaupt erst einen Sinn, eine Bedeutung verleihen, dann muss man in der Datenauswertung den Sprung von der manifesten auf die latente oder Bedeutungsebene vollziehen.“ (Bogner; Littig & Menz 2014: 76 – Hervorhebungen im Text)
Ich bin mir darüber bewusst, dass die Ergebnisse der vorliegenden empirischen Studie nur begrenzt verallgemeinerbar sind, insofern als die individuellen Einstellungen und Sichtweisen der befragten Lehrkräfte keinen Anspruch auf Repräsentativität begründen können (vgl. dazu Schart 2003; Prokopowicz 2017: 92). Dazu ist das Sample zu begrenzt und sowohl geografisch als auch schultypenspezifisch zu sehr verengt.
„Jede Art von Forschung bringt ihre eigenen Stärken und Schwächen mit sich und keine Sicht kann den Anspruch darauf erheben, alles zu erkennen.“ (Schart 2003: 17)
Nichtsdestotrotz bietet das qualitative Forschungsparadigma, das im Folgenden näher zu beleuchten sein wird, einen adäquaten Ansatz für die Forschungsfragen. Diese ergeben sich entsprechend der eingangs beschriebenen Zielsetzungen als forschungsleitende Aspekte für die vorliegende Studie:
1 Was erzählen die befragten, gymnasialen Fremdsprachenlehrkräfte über ihren beruflichen Werdegang und ihr berufliches Selbstbild?
2 Was wissen sie von den Sprachbiografien und den lebensweltlich-kulturellen Erfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler?
3 Wie berücksichtigen sie in ihrem beruflichen Alltag die schulische Mehrsprachigkeit ihrer Schülerschaft?
4 Wie berücksichtigen sie in ihrer Praxis die herkunftssprachlich und -kulturell mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler?
5 Wo sehen sie Änderungsbedarf sowohl für die Unterrichtspraxis als auch für die Lehrerausbildung im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeit?
4.2 Exkurs: Veränderungen der gesellschaftlichen Situation in Deutschland seit der Datenerhebung im Jahr 2012
Mehrsprachigkeit ist aktuell durch die Zuwanderungsbewegungen der Jahre 2015 und 2016 zu einer großen Herausforderung für die Schulen in Deutschland geworden. Seit der Erhebung der hier vorgelegten Daten in den Jahren 2011 und 2012 hat sich die Bedeutung der Zuwanderung nach Deutschland entscheidend verändert und die Situation der verschiedenen Herkunftssprachen in den Schulen stark beeinflusst. Waren zum Erhebungszeitraum Türkisch und – mit Abstand dahinter – Russisch die wichtigsten Herkunftssprachen der Kinder mit Migrationshintergrund1, so hat sich der Sprachenmix zugunsten arabischer Herkunftssprachen verschoben. Durch diese Entwicklung – gepaart mit einer innergesellschaftlichen Diskussion, die nicht immer demokratisch-humanitären Grundvoraussetzungen entspricht – hat sich eine völlige Veränderung der Ausgangsbedingungen für die vorliegende Untersuchung aus den Jahren 2011 und 2012 ergeben.
Mein Fokus liegt weiterhin auf den grundlegenden Aspekten wie der bestehenden Mehrsprachigkeit, sei sie schulisch oder lebensweltlich bedingt. Diese sind unverändert, denn, während die Flüchtlingskrise eine Ausnahmesituation darstellt, ist die lebensweltliche Mehrsprachigkeit durch die Kinder aus türkischen Familien zum Beispiel seit Jahrzehnten der Standard in den Schulklassen.
Im Migrationsbericht der Bundesregierung heißt es zu den Migrationsbewegungen vor 2016:
„Das Zuwanderungsgeschehen nach Deutschland ist seit Jahren vor allem durch Zuwanderung aus anderen europäischen Ländern bzw. Abwanderung in andere europäische Staaten gekennzeichnet. So kamen im Jahr 2015 fast drei Fünftel aller zugewanderten Personen (57,2 %) aus einem anderen europäischen Staat nach Deutschland. Insgesamt betrug der Wanderungssaldo gegenüber den anderen EU-Staaten +332.511. Aus den alten Staaten der Europäischen Union (EU-14) kamen 11,8 % aus den zwölf neuen EU-Staaten (EU-12) 28,2 % und aus Kroatien 2,7 % (zur EU-Binnenmigration vgl. Kapitel 2). Aus dem übrigen Europa kamen 14,5 % aller zugezogenen Personen des Jahres 2015. Weitere 32,2 % der Zugezogenen wanderten aus einem asiatischen Staat zu. Lediglich 5,4 % zogen aus afrikanischen Ländern nach Deutschland und 3,6 % aus Amerika, Australien und Ozeanien.“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016: 31f.)
Читать дальше