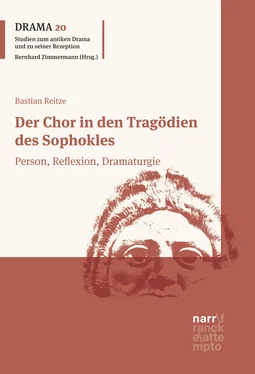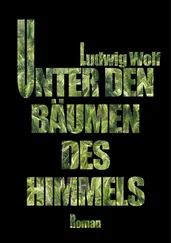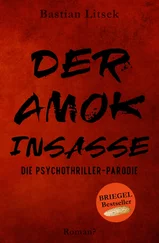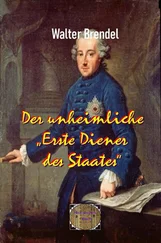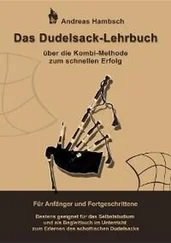Demgegenüber erfährt der Schlaf als Gegenpol des chorischen Fokus im Lauf des Liedes je verschiedene Ausdeutungen: War er als Gottheit am Beginn der ersten Strophe noch Heiler und erbetener Wohltäter – mithin eine mit positiven Attributen versehene, personifizierte Abstraktion –, so thematisiert die Gegenstrophe die Gefahr, die der konkrete und „scharfblickende“ Schlaf des kranken Philoktet für Neoptolemos und den Chor in sich birgt: das Mithören der Intrigenpläne, bzw. genauer das Sehen (λεύσσειν) der wirklichen Gegebenheiten. Die Epode setzt dagegen ein anderes Bild: Der im Schlaf Hingesunkene gleicht in seiner Ohnmacht und Wahrnehmungslosigkeit einem Toten. Dieser Zustand, der dem Protagonisten jeden Kontakt zur und jede Interaktion mit der umgebenden Realität unmöglich macht, steht dabei in scharfem Kontrast zum ὕπνος ἄυπνος (v. 848) der Gegenstrophe, nimmt aber zugleich Begrifflichkeit und Inhalt der ersten Strophe wieder auf und erweitert das dort gezeichnete Bild. So bezeichnet ἀνόμματος (v. 856) eben jenen Zustand, den die Bitte in den Versen 830ff. herbeigesehnt hatte: War dort geradezu aus der Innenperspektive Philoktets von der αἴγλη – „dream light“ – die Rede, die den Augen des Helden vorgehalten werden sollte (ὄμμασι δʼ ἀντίσχοις), so verbalisiert nun νύχιος (v. 857) den augenscheinlichen Eindruck, den der Schlafende bei Betrachtern hervorruft. Dass in beiden Fällen die identische Form von (ἐκ)τείνω (τέταται v. 831, ἐκτέταται v. 857) verwendet wird, macht die Bezugnahme umso deutlicher.10
Herausragende Aufmerksamkeit verdient zum zweiten der konsequent absichtsvolle Gebrauch des Begriffsfelds „Sehen“ innerhalb der Passage. Die Polarität des gedoppelten Blicks auf Philoktet und Neoptolemos tritt hier besonders hervor: Während der Schlaf Philoktet gerade seine Sehkraft nehmen bzw. einschränken soll (v. 830f.) und der so versunkene Held schließlich ἀνόμματος (v. 856) genannt wird, bedient sich der Chor in den Aufforderungen an Neoptolemos dezidiert der Begrifflichkeiten des Sehens und Hinschauens. So leitet der Imperativ ὅρα (v. 833) die dreigliedrige Frage nach Standpunkt und weiterem Vorgehen ein, ἐξιδοῦ (v. 851) fordert zum verborgenen Handeln auf, und ein erneutes ὅρα (v. 862) – diesmal durch βλέπ(ε) gesteigert11 – mahnt zu situationsangepasstem Sprechen. Dementsprechend versichert Neoptolemos den Chor in seiner Antwort, er „sehe“ (ὁρῶ v. 839), dass eine Abfahrt ohne Philoktet dem Orakelspruch widerspreche, wohingegen dessen leichter Schlaf in der Formulierung der Schiffsleute gerade auf Grund des „scharfblickenden Sehens“ (εὐδρακὴς λεύσσειν v. 847f.) eine Gefährdung der vertrauten Gesprächssituation darstellt. Schließlich verbalisiert das futurische ὄψεται (v. 843) die in Aussicht gestellte göttliche Fürsorge um die konkrete Erfüllung der Prophezeiung, während die vom Chor antizipierten ἄπορα πάθη als im wahrsten Sinne „voraussehbar“ (ἐνιδεῖν v. 854) bezeichnet werden.12
Neoptolemosʼ Aufforderung in Vers 865, nun angesichts der wahrnehmbaren Bewegungen Philoktets Stille zu halten, bringt das Lied zu einem entschiedenen Ende. Der Protagonist erwacht und begrüßt sogleich das Licht; sein Monolog (v. 867–881) nimmt daraufhin nach einem Dank an Neoptolemos konkret die Fortführung der Handlung, d.h. den Aufbruch zum Schiff in den Blick (v. 877). Vom verklungenen Chorlied hat Philoktet indes nichts wahrgenommen. Die darin erreichte Zuspitzung der Situation bildet in dieser Hinsicht eine Grundierung, auf der sich gerade das Lob, das der Protagonist Neoptolemos und seiner wohlgearteten Natur (εὐγενὴς φύσις v. 874) entgegenbringt, umso kontrastreicher abhebt. Anders gesagt: Wurde in der chorischen Partie der Fokus dezidiert auf Neoptolemos und seine weiteren Schritte gelenkt, so spitzt sich diese Verengung durch Philoktets Aussagen weiter zu. Die Peripetie wird so in spannungsvoller Kontrastierung bereits antizipierbar.
Machen wir uns an diesem Punkt klar: Der Begriff des Sehens ist für die Motivik des Liedes grundlegend; sie deutet damit den augenscheinlichen Zustand des Protagonisten aus und macht so die konkrete Bühnensituation poetisch nutzbar. Das Begriffsfeld „Sehen“ erfährt in dieser Hinsicht eine spezifische Erweiterung und dramaturgische Aufladung: Indem der Chor auf der einen Seite seine Bitte an den Schlaf richtet, auf der anderen Neoptolemos zu genauem Hinschauen und dementsprechendem Handeln auffordert, thematisiert er die virulente Intrigensituation bildhaft und geradezu handgreiflich. Sehen bedeutet in diesem Zusammenhang, Einsicht über die wahre Situation zu haben und die konkrete Bühnenrealität im Licht des Orakel- und Intrigenzusammenhangs zu begreifen. Anders gesagt: Der ständige Wechsel der Blickrichtung zwischen Philoktet und Neoptolemos wird durch die konsequente Motivik des Sehens zusammengehalten; diese ist der dramatischen Situation, d.h. konkret dem Einschlafen des Protagonisten, entnommen und bildet den Rahmen für die Ausleuchtung der Szenerie und der sich aus ihr ergebenden Konsequenzen für die Handelnden.
Der Aufbau des Liedes, seine charakteristische Perspektive und die damit verbundene geradezu dialektische Frage-Antwort-Relation der drei Strophen untereinander sind verdeutlicht worden. Die Passage erreicht durch diese überlegte Gestaltung und den konsequenten Einsatz einer unmittelbar aus dem Bühnengeschehen erwachsenden Motivik und Begrifflichkeit eine formale Geschlossenheit, die ihrer Positionierung innerhalb des Dramas entspricht: Zwar forciert das Lied den Fortgang der Handlung und weitet sich selbst zur dialogischen Szene. Nichtsdestoweniger füllt es eine Handlungspause, in deren klar konturiertem Rahmen die umfassende Reflexion zu stehen kommt.
Die Szenerie des „Schlafliedes“ korrespondiert mit Blick auf die Gesprächssituation mit der Parodos: Wieder stehen sich Neoptolemos und seine Mannschaft gegenüber, wieder geht es in dieser vertraulichen Unterredung um das weitere Vorgehen (vgl. die ratsuchende Haltung der Choreuten in der Parodos), wobei sich das Verhältnis jedoch verschoben hat. Diesmal ist es nicht Neoptolemos, der den Choreuten Andeutungen zum weiteren Vorgehen macht, sondern der Chor, der seinem Herrn ein gewisses Verhalten vorschlägt – situationsbedingt sehr klausuliert und ambivalent.
Die Präsenz Philoktets auf der Bühne sorgt für einen grandiosen Effekt und inszeniert die Doppelstruktur der Intrigenhandlung plastisch: Während die drastische und effektvolle Handlung um Philoktet selbst zu einem Ruhepunkt gekommen ist, nimmt das Lied die unterschwellig virulente Intrigensituation forciert in den Blick. Damit ist die Intensität der vorangegangenen Szene umgeleitet: Nicht mehr die drastische Bühnenpräsenz des Protagonisten, sondern die spezifische Situation, in der sich Neoptolemos befindet, wird so als Leitthema der sich anschließenden Szene etabliert.
Die Situation der Parodos ist auch mit Blick auf die Anwesenheit des Protagonisten wiederaufgenommen, geradezu transferiert und effektvoll auf die Spitze getrieben: War dort das Nahen Philoktets und damit seine gefühlte Präsenz die Grundlage der bald angstvollen, bald neugierigen Stimmung, so befindet sich an unserer Stelle Philoktet zwar leibhaftig auf der Bühne, ist Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Chor und Akteur, nimmt aber nicht am Gespräch teil. Die Anzeichen seines Aufwachens veranlassen Neoptolemos, das Gespräch zu beenden (v. 865f.), so wie die nahenden Schritte (v. 201) und das deutliche Rufen Philoktets (v. 205f., 218) die Unterredung zwischen den Schiffsleuten und ihrem Herrn zu einem Ende führten.
Indem das Lied dabei zwischen der Beschreibung des schlafenden Philoktet und der sich daraus für Neoptolemos ergebenden Konsequenzen pendelt, verschiebt es den Fokus der Darstellung schrittweise auf Neoptolemos; dessen Handeln wird den weiteren Fortgang der Geschehnisse maßgeblich bestimmen. Machen wir uns daher klar: Das Lied blendet nach dem Höchstmaß an äußerer Drastik die virulente Intrigensituation ein und schafft damit den Übergang zur Konfrontation des Protagonisten mit der eigentlichen Realität. Es bereitet in seiner Umleitung der Drastik und der Problematisierung des Neoptolemos die folgende Szene vor: Wenn Neoptolemos im Anschluss (v. 895ff.) an der Situation scheitert und seinen Gewissenskonflikt offenlegt, so nehmen seine Äußerungen die Begrifflichkeiten der Gegenstrophe (im Besonderen fassbar bei ἄπορον und πάθος) bewusst wieder auf. Deutlich hat sich so die Einschätzung des Chors realisiert, die in der Gegenstrophe antizipierte Situation ist eingetreten. Das Lied hat sich so aus der unmittelbaren Bezugnahme auf die konkrete Situation des Protagonisten zu einer hintersinnigen Ausleuchtung der dramatischen Realität gewandelt. Dass dabei dem impliziten Rat des Chors, Philoktet zu verlassen, die Andeutung größter Schwierigkeiten gegenübergestellt wird, erweist sich im Fortgang der Handlung als konkrete Zukunftsaussicht auf den weiteren Verlauf der Handlung. Die chorische Passage kommt so an einem – scheinbaren – Ruhepunkt der Handlung zu stehen, greift die eingetretene Stimmung auf und moduliert sie in geschickt kontrastierender Weise zu einer brisanten Auseinandersetzung mit der Handlung kurz vor ihrem Wendepunkt.
Читать дальше