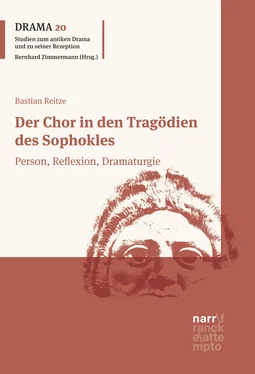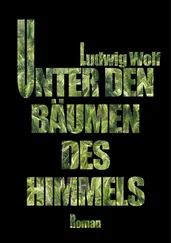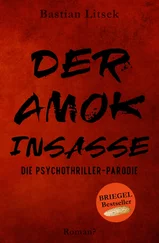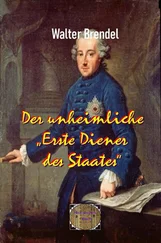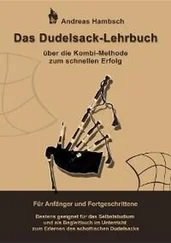Mit Odysseusʼ Auftritt im entscheidenden, geradezu aporetischen Moment (vgl. Neoptolemosʼ hilflose Frage „Was sollen wir tun, Männer?“ und Odysseusʼ entsetzte Auftrittsworte „Was tust du da?“ v. 974) erfährt also die festgefahrene Szenerie eine ungeahnte und überraschende Dynamisierung und personelle Verschiebung. Während bis zu diesem Punkt die im „Schlaflied“ bereits antizipierte Problematisierung des Neoptolemos und seines Verhaltens dramatisch umgesetzt wurde, weitet und vertieft sich durch Odysseusʼ Auftreten die Dimension des Geschehens. Die Feindschaft zwischen ihm und Philoktet wird dabei drastisch inszeniert: Das hochemotionale Rededuell der beiden, die Ankündigung des Selbstmords, die anschließende Fesselung des Protagonisten sowie seine Freilassung bringen einige Aktion auf die Bühne. Neoptolemos steht dabei geradezu zwischen den Fronten und kann erst am vorläufigen Ende des Streits als Herr der Schiffsleute aktiv in das Geschehen eingreifen bzw. dessen weiteren Fortgang ordnen.
Für Philoktet scheint an diesem Punkt der Handlung alles verloren, seine Lage hat sich durch Odysseusʼ Eingreifen und den Abgang der Akteure in Vers 1081 noch einmal akut zugespitzt. Der sich anschließende Kommos überbietet in dieser Hinsicht die bereits emotionalen Monologe in den Versen 927–962 sowie 1004–1044 und leuchtet so die erreichte Situation expressiv aus.
Der eigentliche Wechselgesang besteht augenscheinlich aus zwei Teilen, die sich hinsichtlich ihrer Metrik, der Dialogstruktur und der jeweiligen Bühnenwirkung unterscheiden:1 Auf die beiden Strophenpaare in den Versen 1081–1168 folgt eine Epode2 von beträchtlichem Ausmaß (v. 1169–1217). Die Verse 1218–1221 bilden im Anschluss daran als Auftrittsankündigung für Odysseus und Neoptolemos den konkreten Übergang zur folgenden Szene. Die Sprecherverteilung in den Strophen ist dabei von ausgesuchter Regelmäßigkeit: Auf eine längere Partie des Protagonisten (im ersten Strophenpaar jeweils 14 Verse, im zweiten je 17) antwortet der Chor mit einer kürzeren Einschätzung und Bewertung (je zweimal 6 Verse in jedem Strophenpaar), sodass der Redeanteil Philoktets deutlich überwiegt (62 Verse gegenüber 24 Versen des Chors). Die Epode setzt gegen diese durchsichtige Struktur einen virulenten Akzent: Der rasche Sprecherwechsel, das Nebeneinander von kurzen und längeren Äußerungen und das gegenseitige Ins-Wort-Fallen der Gesprächspartner (v.a. in den Versen 1182f.) lassen den Eindruck einer lebhaften und hochemotionalen Kommunikation entstehen, die sich schon rein formal vom eher statischen Austausch in den beiden Strophenpaaren abhebt.3
Blicken wir nach dieser ersten formalen Einschätzung zunächst auf die im Kommos behandelten Themen und Motive, um den inhaltlichen Aufbau der Partie zu erfassen. Philoktet gibt nach dem Abgang von Odysseus und Neoptolemos seiner Erschütterung und dem Gefühl der Ausweglosigkeit in einem direkten Anruf seiner Höhle Ausdruck: Diesen Ort werde er nun nicht mehr verlassen, ja sogar an ihm sterben (v. 1084f.). Nach einer Klageinterjektion (ὤμοι μοί μοι) folgen zwei schmerzerfüllte Fragen Philoktets: Warum (τίπτʼ v. 1089) werde die mit Leid angefüllte unselige Behausung ihm nun zur täglichen Umgebung (τὸ κατʼ ἦμαρ), und woher solle er jetzt noch – d.h. nach Verlust des Bogens – die Hoffnung auf Nahrung schöpfen? Der Blick zu den am Himmel entlangziehenden Vögeln ist dementsprechend resignierend: Philoktet kann sie nicht mehr einfangen.4
Der Protagonist scheint in dieser ersten Äußerung an einem wirklichen Austausch mit den Schiffsleuten nicht interessiert: Der Fokus seiner Einschätzung liegt ganz auf den Umständen seines eigenen Daseins, wobei vor allem die Höhle und das Problem der Nahrungsbeschaffung im Vordergrund stehen. Eine direkte Ansprache der Choreuten findet nicht statt, die Anwesenheit derselben spielt für Philoktet an dieser Stelle (noch) keine Rolle.
Dennoch melden sich die Choreuten im Folgenden zu Wort (v. 1095–1100) und versuchen, die von Philoktet aufgeworfenen Fragen zu beantworten: Er selbst sei für seine Situation verantwortlich. Nicht das Schicksal (ἁ τύχα) sei hier geradezu „von außen“ (ἄλλοθεν) am Werk, sondern er allein, der die Möglichkeit gehabt hätte, die günstigere Alternative zu wählen, habe sich entschlossen, dem Übleren (τὸ κάκιον) zuzustimmen. Diese alleinige Verantwortung Philoktets wird in der vorliegenden Passage prominent ausgestaltet: So eröffnet das betonte σύ τοι die direkte Wendung an den Protagonisten und rückt ihn selbst in den inhaltlichen Fokus. Indem die beiden einzigen finiten Verbformen (κατηξίωσας und εἵλου) sich gerade auf Philoktet beziehen, ist er als der eigentlich verantwortlich Handelnde gezeichnet, dessen Wahl die Ursache der momentanen Situation darstellt. Die betonte Anrede evoziert dabei eine Gesprächssituation, die so vom Protagonisten in seiner ersten Äußerung nicht intendiert war. Eine Antwort scheint Philoktet nämlich nicht erwartet zu haben und fährt auch im Folgenden fort, ohne direkt auf die Schuldzuweisung von Seiten des Chors näher einzugehen.
Die Gegenstrophe eröffnet mit Vers 1101 ein erneuter Anruf, mit dem Philoktet diesmal konkret seine eigene Person (ὢ ἐγώ) thematisiert: Er selbst, elend (verdoppeltes τλάμων) und von Mühsal geradezu misshandelt (μόχθῳ λωβατός), werde nun zu Grunde gehen (ὀλοῦμαι). Drei Partizipien geben Gründe und Begleitumstände dieser vernichtenden Selbsteinschätzung an: die Wohnsituation (ναίων) in völliger Einsamkeit, die problematische Nahrungsversorgung (οὐ φορβὰν προσφέρων) sowie der Verlust der eigenen Waffen (οὐ … ἴσχων). Dem gerade in den beiden letzten, verneinten Partizipien verbalisierten Mangel setzt Philoktet mit ἀλλά (v. 1111) seine Sicht der Vorgeschichte entgegen: Undeutliche und verborgene Worte eines betrügerischen Verstandes hätten sich eingeschlichen (ὑπέδυ). Philoktet schließt mit einer Verfluchung: Er wolle denjenigen, der das ersonnen habe, die gleiche Zeit seine eigenen Schmerzen erleiden sehen.
Die mit einiger Sicherheit gegen Odysseus gerichtete Invektive (vgl. die folgende Strophe) veranlasst den Chor zu einer unmittelbaren Richtigstellung: Was den Philoktet hier in Besitz genommen habe (ἔσχʼ v. 1119),5 sei das Geschick von δαίμονες, keine List von Seiten des Chors (ὑπὸ χειρὸς ἐμᾶς). Mit Verfluchungen anderer solle er sich daher zurückhalten; denn dem Chor liege daran (ἐμοὶ τοῦτο μέλει), dass Philoktet die gegenseitige Freundschaft nicht von sich stoße.
Offensichtlich haben die Schiffsleute den Protagonisten zumindest leicht missverstanden: Die deutliche Betonung der eigenen Unschuld an Philoktets Leid (vgl. die betonte Hervorhebung der eigenen Person im Possessivpronomen ἐμᾶς v. 1119 sowie das Personalpronomen ἐμοί v. 1121) macht die eingenommene Abwehrhaltung augenscheinlich; dass Philoktet bei seiner Verwünschung konkret Odysseus vor Augen gehabt haben könnte, spielt für den Chor zunächst keine Rolle. Schwerer wiegt für die Schiffsleute der implizite Vorwurf, den die Junktur δολερᾶς φρενός v. 1112 möglicherweise beinhaltete; dementsprechend bildet die entschiedene Zurückweisung eines Betruges (δόλος v. 1117) den wörtlichen Anknüpfungspunkt zur Vorrede des Protagonisten. Der so aufgenommene Begriff δόλος wird scharf von πότμος δαιμόνων unterschieden und findet so seinen Platz in der bereits in den Versen 1095ff. etablierten Terminologie. War dort Philoktet als βαρύποτμος angesprochen worden, der unter Einfluss eines besseren Daimon (λωίονος δαίμονος) anders entschieden hätte, so ist diese Motivik an unserer Stelle zur Junktur πότμος δαιμόνων verschmolzen, die in Abgrenzung zu δόλος erneut besonderes Gewicht erhält. Anders gesagt: Die zweite Wortmeldung des Chors stellt eine Konkretisierung und Verdichtung seiner ersten Aussagen dar, wobei der aus Philoktets Beitrag übernommene Begriff δόλος als virulenter Gegenpol innerhalb der Bewertung die deutliche Selbstverortung des Chors im Geschehen evoziert.
Читать дальше