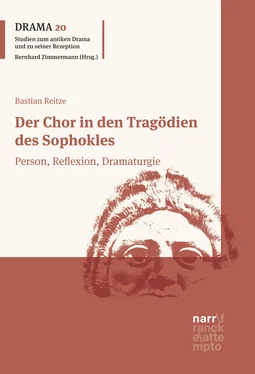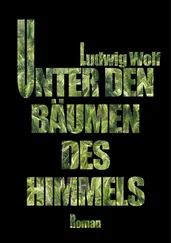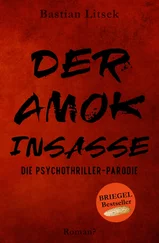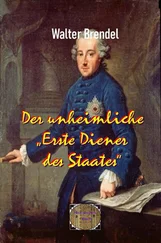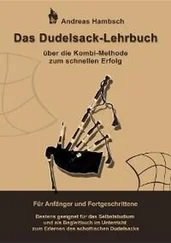Die Form des Liedes spielt dabei meisterhaft mit der Erwartungshaltung des Publikums. Begann die Passage mit ihrer personifizierenden Ausdeutung als ein aus der Situation des Protagonisten motivierter Invokationshymnos, so markiert der Wechsel des Adressaten in Vers 833 das unvermittelte Eintreten in einen Dialog mit dem auf der Bühne verbliebenen Akteur. Aus dem Schlaflied wird so „ein Lied der leisen, aber umso stärkeren Verführung zum Verrat“,13 aus dem rein chorischen, stasimon-ähnlichen Gesang zur Szenentrennung wird ein Austausch zwischen Chor und Akteur, eine Übergangsszene im besten Sinne. Selbst wenn Neoptolemosʼ Anteil an der Unterredung gering ist, evozieren doch die gehäuften Vokative (τέκνον v. 833, 843, 845, 855; παῖ v. 863/4) mitsamt den prominenten Imperativen (ὅρα v. 833, 862; πέμπε v. 846; ἐξιδοῦ v. 851; βλέπ(ε) v. 862) den Charakter eines lebhaften Diskussionsbeitrags von Seiten des Chors, der geradezu auf Antwort bzw. Reaktion ausgerichtet ist.
Fassen wir zusammen: Sophokles nutzt die im Verlauf der Handlung eingetretene Pause durch die Einschaltung einer chorischen Partie zur Umleitung der Drastik und der Wendung des Fokus. Die sich anschließende Peripetie ist damit vorbereitet; anders gesagt: Die Zuschauer sind sich der für Neoptolemos hochproblematischen Situation erneut bewusst und können auf der Folie der im Lied implizit gegebenen Ratschläge die konfliktreiche folgende Szene bereits antizipieren. Das Gespräch zwischen Neoptolemos und dem Protagonisten in den Versen 867ff. hat so als (erster) Wendepunkt innerhalb der Handlung ein chorisches Präludium erhalten, das zum einen die vorangegangene Szene beschließt, dabei allerdings selbst bewusst Szene des Dramas, d.h. Dialog und Austausch zwischen Beteiligten, sein will. Anders gesprochen: Sophokles lässt an dieser Stelle der Handlung keine wirkliche Ruhe aufkommen. Statt in einem reinen Invokationshymnos an den Schlaf die unmittelbare Drastik der Anfallsszene zu lindern und damit dem dramatischen Schwung einen Kontrapunkt entgegenzusetzen, heizt gerade die chorische Partie die dramatische Brisanz weiter an. Den Effekt des „lyric interlude“14 verstärken dabei die konkrete Bühnen- und Sprechsituation, das bewusste, die Erwartungen des Publikums unterlaufende Spiel mit festen Formen chorischer Beteiligung (Invokationshymnos, Stasimon, lyrischer Austausch zwischen Akteur und Chor) und die subtile sprachlich-motivische Komposition, die der Ambivalenz, Uneindeutigkeit und „Chiffrierung“15 der Sprache eine besonders subversive Wirkung verleiht.
Kommos Philoktet-Chor (v. 1081–1217)
Mit dem Wechselgesang v. 1081–1217 kommen wir zur letzten umfangreichen Chorpartie der Tragödie. Bevor die Gesprächssituation, die formale Anlage der Passage, ihre Motivik und Thematik sowie die dramaturgischen Implikationen erläutert werden, soll ein kurzer Überblick die Einordnung des Kommos in den Handlungsablauf ermöglichen.
Nach dem Aufwachen des Protagonisten hatte Neoptolemos die Wahrheit nicht mehr zurückhalten können und Philoktet mit den Gegebenheiten konfrontiert: Es sei notwendig (δεῖ v. 915, πολλὴ κρατεῖ ἀνάγκη v. 921f.), gemeinsam nach Troia zu fahren und dort die Stadt einzunehmen. Philoktet reagiert erschüttert; in einem ersten Monolog (v. 927–962) konfrontiert er seinen Gesprächspartner mit schwerwiegenden Vorwürfen: Er, ein Schutzbedürftiger (προστρόπαιος, ἱκέτης v. 930) sei getäuscht, geradezu hinters Licht geführt worden (besonders eindrücklich die Perfektformen ἠπάτηκας v. 929 und ἠπάτημαι v. 949). Wenigstens den Bogen solle man ihm zurückgeben, denn mitsamt diesem Utensil habe man ihm das Leben selbst geraubt (v. 931ff.). Dementsprechend fällt das Urteil über seinen eigenen Zustand vernichtend aus: οὐδέν εἰμʼ ὁ δύσμορος (v. 951). Neoptolemos antwortet trotz der mehrfachen direkten Ansprache durch Philoktet nicht (v. 934f., 951), bekundet allerdings nach der an ihn gerichteten Frage des Chors nach dem weiteren Vorgehen (v. 963f.) sein überaus großes Mitleid (οἶκτος δεινός), das ihn nicht erst jetzt, sondern schon vor längerer Zeit befallen habe.
Bevor es zu einer Übergabe des Bogens und Entscheidung für oder gegen die Abfahrt nach Troia bzw. in Philoktets Heimat kommen kann, betritt Odysseus ohne Vorankündigung die Bühne. Zum ersten Mal treten so die drei wesentlichen Akteure der Handlung in direkte Auseinandersetzung. Philoktet wird sich rasch bewusst, dass letztlich Odysseus für seine momentane Lage verantwortlich ist (v. 978f.), und droht schließlich, sich der Situation durch einen Sprung vom Felsen zu entziehen (v. 999f.). Odysseusʼ Gehilfen packen den Protagonisten daraufhin und verhindern so die Selbsttötung. Philoktet, nunmehr festgehalten von Statisten, greift in einem zweiten Monolog (v. 1004–1044) Odysseus scharf an: Dieser habe Neoptolemos, den Philoktet unbekannten Knaben (παῖδα ἀγνῶτʼ ἐμοί v. 1008), geradezu als Schutzwehr (πρόβλημα) benutzt, um sein Vorhaben umzusetzen. Ein entschiedenes ὄλοιο (v. 1019) bringt Philoktets Verachtung und Entrüstung gegenüber Odysseus wirkungsvoll zur Sprache. Selbst die erfolgte Festsetzung und Überführung seiner selbst nach Troia, so Philoktet, werde für die Griechen keinen Vorteil bringen: In seinem Zustand – lahm und stinkend (χωλός, δυσώδης v. 1032) – stelle er bei der Eroberung Troias eher ein Hindernis als eine Unterstützung dar. Die Ursache seiner Aussetzung auf Lemnos, d.h. seine Krankheit und die daraus erwachsenen Probleme, seien schließlich noch immer virulent. Philoktet schließt mit einer Anrufung der Götter seiner Heimat (v. 1040ff.): Diese sollten die für sein Leid Verantwortlichen allesamt (ξύμπαντας) bestrafen; denn selbst unter diesen widrigen Lebensbedingungen (ζῶ οἰκτρῶς v. 1043) könne Philoktet die Gewissheit um die Bestrafung seiner Widersacher geradezu als Befreiung von seiner Krankheit empfinden.
Wieder ist es der Chor, der nach dem Monolog des Protagonisten eine kurze Einschätzung gibt, diesmal in Form einer direkten Anrede an Odysseus (v. 1045f.): Philoktet habe eine heftige Rede gehalten, die kein Anzeichen eines Nachgebens erkennen lasse. Der Angesprochene bekundet, er wolle nun nicht viele Worte machen. Zwar wünsche er, Odysseus, in der Regel, den Sieg aus einer Situation davonzutragen, Philoktet aber lasse er freiwillig zurück. Denn, so die Einschätzung, mit dem Besitz des Bogens bestehe keine Notwendigkeit, Philoktet selbst nach Troia zu bringen. Er gibt schließlich den Befehl, Philoktet loszulassen, und fordert Neoptolemos auf, nun mit ihm selbst zum Schiff zu gehen. Nacheinander wendet sich Philoktet daraufhin in je einem Doppelvers an Odysseus (v. 1063f.), Neoptolemos (v. 1066f.) und den Chor (v. 1069), verfehlt allerdings sein Ziel, die übrigen Akteure durch seine erschüttert-ungläubigen Fragen zum Bleiben zu bewegen. Der Chorführer macht sein weiteres Vorgehen von Neoptolemosʼ Vorgaben abhängig. Dieser gibt daraufhin in den Versen 1074ff. eine – zumindest für den Moment – klare Handlungsanweisung: Er fordert den Chor auf, bei Philoktet zu bleiben, während er selbst mit Odysseus zu den Göttern beten wolle. Vielleicht, so seine Hoffnung, werde Philoktet noch zu einem anderen, der eigenen Sache günstigeren Entschluss kommen. Sobald er jedenfalls das Signal zum Aufbruch geben werde, sollten sich auch die Schiffsleute rasch aufmachen. Nach diesen Worten verlassen Neoptolemos und Odysseus das Geschehen, zurück bleiben Philoktet und der Chor.
Machen wir uns an diesem Punkt die Bühnensituation erneut klar: Mit Neoptolemosʼ Eingeständnis in den Versen 895ff. hat die bisher virulente Doppelbödigkeit der Handlung ein Ende gefunden. Schrittweise erfährt nun auch der Protagonist die eigentlichen Hintergründe der Geschehnisse, wobei der überraschende Auftritt des Odysseus in Vers 974 die Klimax der Szenerie darstellt: Zum ersten Mal stehen sich nun die beiden Antipoden der Handlung konkret gegenüber. Die seit dem Prolog bereits antizipierbare Konfrontation des ‚Strippenziehers‘ Odysseus mit dem Hauptleidtragenden seiner Intrige bringt damit den Kern der Personenkonstellation auf die Bühne; Neoptolemos und der Chor folgen dementsprechend dem Streitgespräch der beiden Akteure lange Zeit wortlos, einzig die kurze Einschätzung des Chorführers v. 1045 unterbricht diese Zurückhaltung. Erst die Antwort auf Philoktets direkte Ansprache und die darauf von Neoptolemos gegebenen Handlungsanweisungen (v. 1072ff.) bilden die erste Einschaltung der durch die Bühnenpräsenz des Odysseus und die Intensität des wortreichen Konflikts geradezu ins Abseits geratenen weiteren Charaktere.
Читать дальше