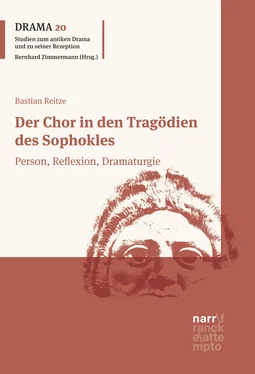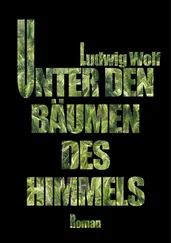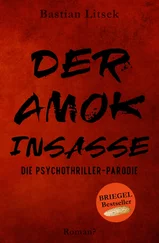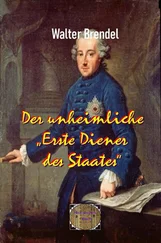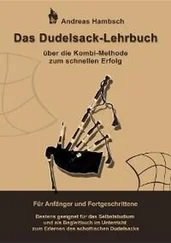Philoktets Hinsinken und Einschlafen in den Versen 819ff. lassen die unmittelbare Drastik zu einem vorläufigen Ende kommen: Das Lied des Chors scheint zunächst, wie schon das Stasimon, die eingetretene Pause im Verlauf der Handlung zu füllen. Die Szenerie ist allerdings eine ganz andere: Neben dem Chor befinden sich Philoktet – wenn auch schlafend – und Neoptolemos weiterhin auf der Bühne. Das mit Vers 827 beginnende Lied wird sich so zu einer Unterredung weiten, die mit dem Verweis auf die Intrigensituation die Brisanz der Szene in Erinnerung rufen und verdeutlichen wird.2 Ein detaillierter Nachvollzug gerade der ersten Strophe wird grundlegende Strukturen des Liedes herausstellen; die beiden weiteren Strophen können daraufhin kürzer abgehandelt werden.
Die Aufforderung des Neoptolemos, den erschöpften Philoktet in Ruhe dem Schlaf zu überlassen (v. 826), findet ihre begriffliche Fortsetzung mit dem Beginn des Liedes: Ein direkter Anruf des Schlafes eröffnet die chorische Partie. Doch nicht nur die gedoppelte Wiederholung des Wortes Ὕπνος in Vers 827 macht die Kontextbezogenheit der chorischen Aussagen besonders deutlich: Indem der Schlaf als unkundig (ἀδαής) im Bereich von Schmerz (ὀδύνας) und Leiden (ἀλγέων) apostrophiert wird, ist die vorangegangene Szene mit ihrer drastischen Inszenierung von Philoktets Qualen verbalisiert und zugleich als vergangen gekennzeichnet. Nun solle eben der Schlaf kommen (ἔλθοις), wobei sich die Choreuten durch ἡμῖν (v. 828) bewusst als in die Situation involviert verstehen.3 Die Häufung der Adjektive (ἀδαής, εὐαής sowie das verdoppelte εὐαίων) erweckt neben der gezielten Ansprache des Gottes dabei den Eindruck eines kultischen Invokationshymnos, der die Epiphanie der betreffenden göttlichen Person herbeisehnt.
Die angeschlossene konkrete Bitte in den Versen 830f. bietet im Einzelnen manche Schwierigkeit, v.a. hinsichtlich der konkreten Bedeutung von τάνδʼ αἴγλαν. Man wird wohl am besten mit JEBB αἴγλα als das „Traumlicht“4 verstehen, das der Schlaf dem Niedergesunkenen nun vorhalten soll. WEBSTER illustriert gerade mit Blick auf das abschließende Παιών (v. 832/3) – ein stereotypes Epitheton des Asklepios – die begrifflich-genealogische Verbindung, die der Chor an unserer Stelle zwischen Ὕπνος und dem Gott der Heilung samt seiner Tochter Αἴγλα herstellt. Die in Frage stehende Junktur τάνδʼ αἴγλαν kann so ebenfalls als mit der Heilung einhergehender „Schimmer von Gelassenheit“ verstanden werden, der Philoktet nun zuteilwerden solle bzw. bereits zuteil geworden ist.5 Allen Deutungen gemein ist die von Ὕπνος erbetene „Bewusstlosigkeit“ Philoktets, der im Schlaf nicht mehr von seinen akuten Leiden gequält werden soll; dass er dabei von der aktuellen Situation, d.h. dem sich anschließenden Gespräch des Chors mit Neoptolemos nichts wahrnehmen kann, ist implizit bereits angedeutet und, wie der Verlauf des Liedes zeigen wird, elementarer Bestandteil der Bitte an die Gottheit.
Mit Vers 833 bricht der begonnene Invokationshymnos ab; der Chor richtet sein Augenmerk auf Neoptolemos und redet ihn mit ὦ τέκνον direkt an. Der Vokativ steht so im bewussten Kontrast zum vorangegangenen Ὕπνʼ (v. 827) und macht die Verschiebung der Perspektive deutlich: Nicht mehr der herbeigerufene Schlaf steht im Fokus des Interesses, sondern Neoptolemos und sein weiteres Vorgehen. Dieser solle sich nämlich, so die Aufforderung der Schiffsleute, über seinen eigenen Standpunkt klar werden (ποῦ στάσῃ), bedenken, welche Schritte er nun in Angriff nimmt (ποῖ βάσῃ), und wie mit den sich aus der Situation ergebenden Sachverhalten (τἀντεῦθεν) umgegangen werden soll. Der Chor scheint aus seiner Perspektive bereits die notwendigen Konsequenzen gezogen zu haben: Worauf, so die entschiedene Frage v. 836, müsse man noch warten; der richtige Augenblick, der Einsicht über alle Dinge besitze, gewinne jedenfalls großen Einfluss durch eine schnell ausgeführte Aktion.
Erst die Antwort des Neoptolemos konkretisiert die allenfalls implizit andeutenden und keineswegs leicht zu verstehenden Aussagen des Chors: Zwar höre Philoktet zur Zeit nichts, er aber, Neoptolemos, sehe, dass das ganze Unternehmen vergeblich in Angriff genommen wurde, sollte man jetzt mit dem Bogen nach Troia fahren, den Helden selbst aber auf Lemnos zurücklassen. Philoktets Herbeischaffung habe das Orakel gefordert, ihm gelte der Siegeskranz; überhaupt sei es schwere Schmach, sich einer mit Lügen ausgeführten und letztlich erfolglosen Mission zu rühmen.
Machen wir uns an diesem Punkt bewusst: Der inhaltliche Fokus des Liedes und des daraus hervorgegangenen Austauschs zwischen Chor und Akteur hat sich im Lauf der Strophe auf eine andere Ebene verlagert. Nicht mehr das Leid des Protagonisten und die Möglichkeit, es zu lindern, stehen im Mittelpunkt. Vielmehr erfährt die gegenwärtige Lage Philoktets ihre polarisierende Ausdeutung im Kontext der Intrigensituation: Indem der Chor zwar äußerst ambivalent,6 für seinen Gesprächspartner aber durchaus verständlich, zum sofortigen Einschreiten auffordert, füllt er die entstandene Pause im Handlungsablauf mit ungeahnter Dynamik. Der Kontrast zwischen der Anrufung des Schlafs und der unerwarteten Gesprächsaufnahme mit Neoptolemos macht dabei den Wechsel der Fokussierung besonders deutlich.
Die in der ersten Strophe virulente Zweiteilung der Blickrichtung – einmal auf den Protagonisten und seinen Zustand, einmal auf Neoptolemos und die sich aus der Situation für ihn ergebenden Konsequenzen – prägt auch den Fortgang des Liedes. Während sich Neoptolemos selbst nicht mehr zu Wort meldet und erst in Vers 865 dem Chor Stille gebietet, entfalten die Schiffsleute ihre Ausdeutung der momentanen Situation als selbstbewusste Handlungsempfehlung an ihren Herrn. So legen sie ihm in ausgesuchter Ambivalenz nahe, die nun eingetretene Gelegenheit beim Schopf zu packen und zu seinen Gunsten zu nutzen. Ein kurzer Überblick über die beiden folgenden Strophen soll dies verdeutlichen.
Den Bedenken des Neoptolemos hinsichtlich der durch den Orakelspruch geforderten Mitwirkung Philoktets an der Einnahme Troias tritt der Chor pragmatisch entgegen: Danach werde Gott selbst sehen (τάδε μὲν θεὸς ὄψεται v. 843). Ihr Herr solle im Moment, so die angeschlossene konkrete Bitte in den Versen 844ff., nur leise antworten, da der Schlaf von Kranken „scharfblickend“ (εὐδρακὴς λεύσσειν) sei und so – implizit gesagt – die Gefahr bestehe, von Philoktet gehört zu werden. Weiterhin solle Neoptolemos genau Acht geben (ἐξιδοῦ v. 851), dass er das angedeutete Unternehmen (κεῖνο) in aller Heimlichkeit ausführe; wenn er dagegen an seiner Meinung festhalte,7 könne man als verständiger Beobachter schon jetzt schwierige und ausweglose Ereignisse (ἄπορα πάθη) voraussehen.
Gegen diese negative Zukunftsaussicht setzt die Epode mit Vers 855 einen erneut auffordernden Blick auf die aktuelle Gegenwart: Für Neoptolemos sei jetzt eine günstige Gelegenheit (οὖρος) eingetreten, da Philoktet gleich einem Toten ohne Macht über seinen eigenen Körper hingestreckt sei. Ein erneutes ὅρα (v. 862 vgl. v. 833) eröffnet eine letzte Aufforderung an Neoptolemos: Er solle zusehen, ob er der Situation angemessene Dinge spreche (καίρια φθέγγῃ); die Vorgehensweise mit der größten Aussicht auf Erfolg sei aus Sicht der Choreuten – bemerkenswert das betonte ἐμᾷ φροντίδι v. 864 – ein furchtloses Handeln (πόνος μὴ φοβῶν κράτιστος).
Die sorgfältige sprachlich-motivische Gestaltung der Chorpassage soll hier nicht unerwähnt bleiben.8 Zwei Aspekte treten dabei besonders deutlich hervor.
Zum ersten: Wie schon erwähnt, prägt der gedoppelte Blick auf Philoktet und Neoptolemos die gesamte Partie.9 Wiederkehrendes und geradezu gliederndes Moment sind dabei die Anreden an Neoptolemos sowie die begriffliche Thematisierung des Schlafs, an deren gegenseitigem Wechselspiel innerhalb des Liedes die spezielle Perspektive des Chors auf die Situation verdeutlicht werden kann: Unterbricht der Vokativ (ὦ) τέκνον v. 833 in der ersten Strophe den durch das verdoppelte Ὕπνε volltönend begonnenen Invokationshymnos, so nimmt diese vertraute Anrede auch in den beiden folgenden Strophen prominente Stellungen ein. Sie eröffnet die Gegenstrophe (v. 843) und markiert so die bewusste Antwort auf Philoktets Einwand, wird in Vers 845 zur Intensivierung der Aufforderung nach gedämpfter Lautstärke wiederholt und steht erneut am Beginn der Epode v. 855, um dem Angesprochenen die günstige Lage geradezu plastisch vor Augen zu führen οὖρός τοι, τέκνον, οὖρος. Wenn der Chor am Schluss des Liedes (v. 864) seinen Herrn mit παῖ anspricht, so lässt diese Variation aufmerken und macht den besonderen Nachdruck der vom Chor vorgebrachten Empfehlung erfahrbar. Die p-Alliteration des Vokativs mit dem aus Vers 835 übernommenen φροντίδος und dem folgenden πόνος ist dabei ein starkes Mittel, das der Passage erneut Nachdruck verleiht; anders gesagt: Die in der ersten Strophe aufgeworfenen Fragen an Neoptolemos, v.a. πῶς δέ σοι τἀντεῦθεν φροντίδος v. 834, sind hier am Ende der Passage aus Sicht des Chors trotz aller Ambivalenz deutlich und unmissverständlich beantwortet.
Читать дальше