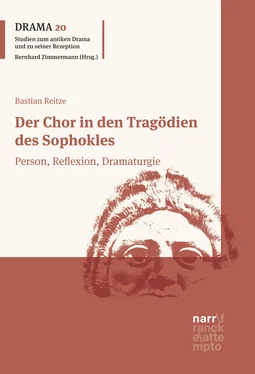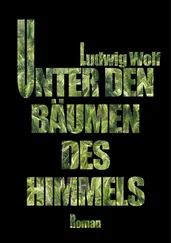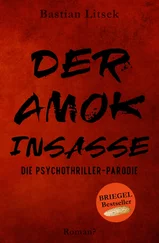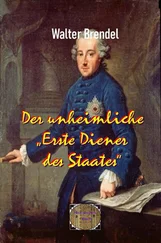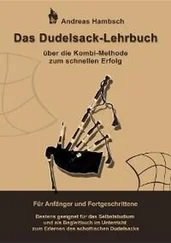Seine besondere dramaturgische Brisanz erfährt das Stasimon aus der bewussten Differenz zwischen dem in ihm ausgedeuteten Zeitverhältnis und dem unmittelbaren Zusammenhang innerhalb des Handlungsverlaufs. Konkret gesagt: Das Wissen des Zuschauers um die dramatische Situation mitsamt der zu ihrem Höhepunkt entwickelten Intrige macht ein affirmatives Nachvollziehen der chorischen Ausdeutung schwierig, geradezu unmöglich. Dabei fällt nicht nur die umstrittene zweite Gegenstrophe aus dem Rahmen. Schon der Blick in die Vergangenheit, wie ihn das Stasimon entwirft, ist dabei problematisch: So entspricht das hier in den ersten drei Strophen gezeichnete Bild des Protagonisten nur zum Teil der im Drama bisher erlebten Präsenz. In seiner ausführlichen Drastik und Zentrierung auf das Leid stellt es einen leichten Gegenpol zum bereits zitierten Monolog des Helden (v. 254–316) dar, der – neben Klage und Jammer – den Fokus eher auf die Bewältigung der einzelnen Probleme legte.39 Anders gesagt: Philoktet war auf der Bühne zwar durchaus als Leidender präsent, die ausgreifende Farbigkeit und Drastik entspringt allerdings an unserer Stelle – wie schon in der Parodos – der Imagination des Chors und hat keinen direkten Rückhalt im dramatischen Spiel. Diese subtile Akzentverschiebung findet ihren Gegenpart im Ausblick auf die Zukunft: Dass Philoktet nun „glücklich und groß“ aus den gegenwärtigen Übeln hervorgehen werde, entspricht genauso wenig der Erwartung des informierten Zuschauers und der sich anschließenden Szene wie die drastische Zeichnung der Vergangenheit der bisherigen Realisierung von Philoktets Leid auf der Bühne. Das reale, d.h. dramatische Zeitverhältnis, ist im Vergleich zum Stasimon gerade umgekehrt: Während die Bühnenhandlung bis jetzt einen zwar leidenden, jedoch standhaften und ausdauernden Philoktet inszeniert hat, gehört der vom Stasimon im Rahmen einer Vergangenheitsschau geschilderte Ernstfall der Einsamkeit und Hilflosigkeit, d.h. der Krankheitsanfall, der kommenden Szene an. Nicht nur, dass damit der optimistische Ausblick schlagartig mit der eindrucksvollsten, emotionalsten und eindringlichsten Szene kontrastiert; die Ausgestaltung der Vergangenheit realisiert sich als entscheidendes, die Peripetie auslösendes Moment der Tragödie in ungeahnter Drastik. Dass dabei dem leidenden Protagonisten bei seinem Anfall ein „Freund“ zur Seite steht, stellt natürlich eine gewisse Abweichung zu dem in der ersten Gegenstrophe präsenten und bestimmenden Einsamkeitstopos dar. Die unverhohlene Anschaulichkeit der Szene ruft allerdings das im Stasimon evozierte Bild in seiner ganzen Wirkmächtigkeit wieder auf, während die von Neoptolemos an den Tag gelegte Hilflosigkeit angesichts der konkreten Phänomene des Anfalls und das völlige Schweigen des Chors bis Vers 827 die Krankheitssituation nur wenig beeinflussen.
Halten wir fest: Die geradezu standardisierte Funktion eines Stasimons, die einbrechende Katastrophe bzw. Wendung auf der Folie einer positiven Zukunftsaussicht umso greller hervortreten zu lassen,40 ist an unserer Stelle meisterhaft erreicht: Das Stasimon forciert den Wendepunkt innerhalb der Tragödie, untergräbt allerdings mit einer eigenen sinnstiftenden Zeitverortung des Geschehens das eigentliche Handlungsgefüge. Die Kontrastierung der unterschiedlichen Bildwelten und Emotionen am Ende des Stasimons (Heimkehr und Größe Philoktets, Vergöttlichung des Herakles) und am Beginn der folgenden Szene (Ausgeliefertsein des Helden an Krankheit, Leiden und Schmerz sowie generelle Hilflosigkeit) potenziert dabei geradezu ihre Wirkung, da die positive Stimmung der Schlussstrophe gerade aus der Negierung just dessen gewonnen wurde, was das folgende Epeisodion inszeniert. Aus einem „nicht mehr“ wird so ein überdeutliches „jetzt gerade“. Das Zeitgefüge der chorischen Reflexion ist damit gebrochen: Die dramatische Realität pervertiert das vom Chor entworfene Deutungsschema, so wie das Lied in seinem Blick in die Vergangenheit bereits die Handlung selbst umgedeutet hatte. Man mag in diesem Zusammenhang von einer geradezu doppelten Pervertierung sprechen.
Im bewussten Auseinanderfallen der dramatischen Sachlage sowie der chorischen Deutung liegt – wenn man sich von anderen Deutungsversuchen distanziert und zudem versucht, den Text des Liedes ohne parallel einhergehendes Bühnengeschehen (Auftritt oder Erscheinen der Akteure41) als chorische Ausdeutung zu lesen42 – die Spannung des Stasimons und letztlich seine dramaturgische Absicht. Es fügt sich nicht in die Erwartungen des Publikums, sondern konterkariert diese bewusst. Die (antiken) Zuschauer werden sich der vorliegenden Ambivalenz und der doppelten Pervertierung bewusst gewesen sein. Geht man neben einer zumindest rudimentären Informiertheit über die Grundstrukturen des dramatisch verarbeiteten Mythos von einer gewissen Vertrautheit mit den basalen Techniken der (sophokleischen) Tragödie, ihren Formteilen und deren genregemäßem Einsatz aus, dann wird man die (freilich unbewiesene und wohl auch unbeweisbare) Hypothese aufstellen dürfen, der Zuschauer im Theater habe ahnen oder gar wissen können: Je positiver der Chor in einer kritischen bzw. ambivalenten Situation die Zukunft zeichnet, desto näher, umfassender und katastrophaler ist die meist im direkten Anschluss folgende Wende. In anderen Worten: Die augenscheinliche Differenz zwischen Bühnenhandlung und chorischer Ausdeutung erlaubt an unserer Stelle einen Blick hinter die dramatische Fiktion – die dennoch nicht aufgehoben ist – und lässt gerade einen informierten bzw. vertrauten Zuschauer die dramaturgische Funktion und den weiteren Fortgang des Bühnengeschehens erkennen.43
Mit diesem Deutungsversuch nehme ich eine mögliche Inkonsequenz innerhalb der Charakterisierung des Chors hinsichtlich seiner Stellung innerhalb der Intrige bewusst in Kauf. Ich stimme in diesem Punkt allerdings ganz BURTON zu, der im Bezug auf „Sophoclesʼ habit of using his choruses as an instrument with which to guide the mind and emotions of his audience in any direction required by the immediate dramatic context“44 anmerkt:
This role of the chorus leads in occasion to inconsistencies between parts of the same song and between one song and another which can only be explained if we always remember the presence of an audience whose thoughts and feelings have to be engaged and directed.45
Dass das Publikum an einer so motivierten Inkonsistenz Anstoß genommen haben könnte, erscheint mir dabei zweifelhaft.
An der grundsätzlichen Einbindung des Chors als Rolle innerhalb des Dramas will diese Ausleuchtung dagegen in keiner Weise rütteln.46 Will man das Verhalten des Chors, genauer: das der Matrosen des Neoptolemos erklären, so wird man sich am besten MÜLLER47 anschließen und von einem Irrtum, d.h. einer falschen Einschätzung der Lage, ausgehen. Diese Anschauung bleibt allerdings für sich gesehen unbefriedigend; die funktionellen, d.h. publikumswirksamen Konsequenzen dieses Irrtums kann erst eine genuin dramaturgische Betrachtung wie die hier vorgelegte erweisen.
Bis zur Hälfte der Tragödie hat Sophokles bereits ein reiches Panorama unterschiedlicher Formen chorischer Präsenz zum Einsatz gebracht: die dialogische Parodos mit anapästischen Einschüben des Neoptolemos und umrahmter Kurzode, die korrespondierenden Strophen innerhalb des ersten Epeisodions sowie das traditionelle Standlied des Chors auf leerer Bühne.
Während dabei die Parodos als dialogische Szene unter Dauerpräsenz des Neoptolemos und die in das erste Epeisodion eingestreuten Strophen sich in den dramatischen Fluss eingeordnet haben, fügt Sophokles an unserer Stelle eine bewusste Pause innerhalb der Handlung ein. Das Stasimon kommt dabei zwischen zwei äußerst dynamischen Szenen zu stehen: Während das vergangene Epeisodion die Annäherung zwischen Neoptolemos und Philoktet unter struktureller Präsenz des Chors inszenierte und die entscheidende Verschärfung der dramatischen Brisanz in Form eines außerszenischen Impulses verwirklichte, wird der kommende Auftritt der Akteure die bisher drastischste Szene der Tragödie darstellen.
Читать дальше