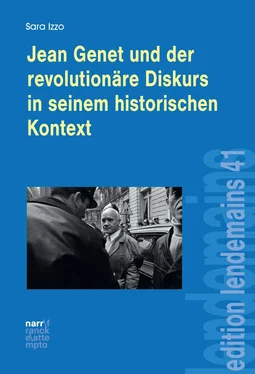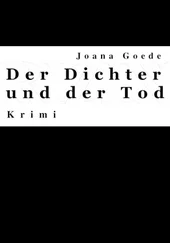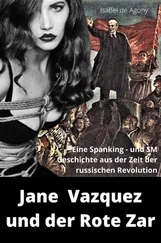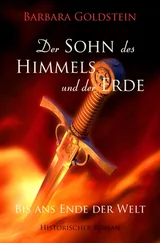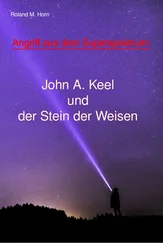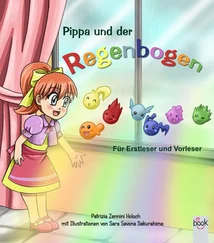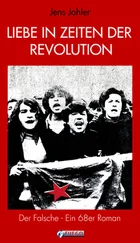Als spezifische Krise des französischen Universitätssystems und damit der französischen Intelligenz beschreiben Ory/Sirinelli das Aufbegehren der Studierenden als „surrection de la jeunesse intellectuelle contre ses pères les plus officiels, mais qui, portée par l’exemple de quelques maîtres bien précis, reçut le ralliement fasciné de plusieurs grands noms de la haute intelligentsia établie“13. Dazu zählen für die beiden Verfasser insbesondere Jean-Paul Sartre, „se situant une fois de plus au centre des tendances intellectuelles du temps“14, und in dessen Folge beispielsweise Michel Foucault, Maurice Clavel und Jean Genet, auch wenn durch diese undifferenzierte Inbezugsetzung zu Sartre deren Wechselbeziehungen und geistiger Austausch nur angedeutet werden: Mais un tel raisonnement [celui de Sartre, S.I.], partagé dans les premières années qui suivirent Mai par un Maurice Clavel (1920–1978), un Michel Foucault ou un Jean Genet (1910–1986), pour ne citer que trois personnalités assez représentatives de trois différentes légitimités intellectuels – un ‚journaliste‘, un ‚philosophe‘, un ‚poète‘ – n’était pas sans influer à son tour sur l’œuvre même de ses personnages.15 Als Trias unterschiedlicher intellektueller Legitimitäten dargestellt, muss zum einen die damit verbundene Differenzierung deren Funktionen im öffentlichen Raum und zum anderen die jeweilige persönliche Entwicklung und Haltung gegenüber der Rolle des Intellektuellen berücksichtigt werden. So betreten Foucault und Genet im Gegensatz zu Sartre in den années 68zum ersten Mal die politische Bühne, schaffen jedoch jeweils eine Rückbindung an ihr bis dahin veröffentlichtes Werk und theoretisieren ihr Engagement entsprechend ihrem spezifischen Interessenbereich. Gilcher-Holtey betrachtet Mai 1968 als soziale Bewegung, deren kognitive Konstitution nicht allein durch eine Universitätskrise determiniert wird.16 In ihrem Verständnis beziehen die Trägergruppen einer Bewegung ihre kognitive Identität prozessual durch „die Herausbildung einer internen Kommunikationsstruktur, eines symbolischen Systems der Selbstverständigung und der Selbstgewissheit, die Handlungsrichtung und intersubjektive Handlungsbereitschaft bestimmen.“17 Diese Form des Austausches bezeichnet sie als „kognitive Praxis“, die „durch Ordnungsentwürfe von Intellektuellen und ihre Umsetzung in handlungsrelevante Zielvorstellungen“18 determiniert werde. Wenn auch die Rolle der etablierten Intelligenz im Mai 1968 als sekundär zu bezeichnen ist – weder Sartre noch Foucault oder Genet waren inder Bewegung –, so greift sie doch Teilelemente der Bewegung auf und führt sie weiter, wie beispielsweise die Schaffung des G.I.P. und des darin symbolisierten neuen Interventionsschemas zeigt. Im Lichte von Winocks Klassifizierung unterschiedlicher intellektueller Interventionsformen legen sie als Befürworter der sozialen Umbrüche und Proteste ihre eigene Funktion grundsätzlich entsprechend der des kritischen Intellektuellen aus, indem nämlich politische und vor allem rechtliche Autoritäten angezweifelt werden. Dabei zielen sie jedoch unter Einwirkung der öffentlichen Transformationsprozesse darauf ab, neue Handlungskonzepte zu entwerfen. Gilcher-Holteys Ausführungen in Eingreifendes Denkenzufolge werden die Distinktions- und Positionskämpfe im intellektuellen Feld am Ende des 20. Jahrhunderts durch drei konkurrierende Typen des Intellektuellen determiniert, die den Diskurs maßgeblich prägen: der ‚allgemeine‘, der ‚revolutionäre‘ und der ‚spezifische‘ Intellektuelle.19 Diese intellektuellen Handlungsentwürfe entstehen in Reaktion auf die gesellschaftliche Situation des Umbruchs und vermitteln unterschiedliche Deutungs- und Wahrnehmungsformen der sozialen Welt. Im Gegensatz zu Sartres durch die Maiereignisse transformierter Rolle des ‚universellen‘ Intellektuellen und Foucaults Ideal des ‚spezifischen‘ Intellektuellen, welche auf theoretisch fundierten und hergeleiteten Konzepten des politischen Engagements basieren, bleibt Genets Reaktionsform nur schwer klassifizierbar, wie in der sich anschließenden vergleichenden Analyse ermittelt werden soll. Julliard und Winock widmen ihm einen Artikel im Dictionnaire des intellectuels français, in dem die Unabhängigkeit als Schlüssel seines politischen Engagements benannt wird: „L’indépendance est la clé de son parcours intellectuel. […] Il renouvelle le modèle sartrien de l’écrivain engagé en refusant de se substituer aux hommes politiques et en choisissant les causes qu’il défend pour des raisons intimes et personnelles.“20 Genets politisches Engagement muss an jenen Merkmalen ausgerichtet werden, die den Intellektuellen allgemein kennzeichnen, nämlich an seinem in einem anderen Bereich erworbenen Prestige und an dessen zielorientiertem Transfer in die politische Öffentlichkeit zugunsten einer gesellschafts- und handlungsrelevanten Richtungsweisung. Dabei müssen seine Haltung zum eigenen Prestige und zu dessen Wirkungskraft in der Öffentlichkeit ebenso beleuchtet werden wie seine Positionierung zur intellektuellen Interventionsform und ihren unterschiedlichen Ausprägungen. 2.1 Jean Genet im Fokus der medialen Öffentlichkeit: Zwischen revolutionärer Emblematisierung und Anonymitätsgebot Die gesellschaftlichen Veränderungen, welche sich in den Protestbewegungen der 1960er und 1970er widerspiegeln und durch diese vorangetrieben werden, zwingen die Intellektuellen zu einer Redefinition ihrer eigenen Funktion. Ein Widerspruch der sich auflehnenden Generation ist die offensive Ablehnung jedweder Autoritäten und Idole einerseits und der Prozess der Emblematisierung einzelner Persönlichkeiten zu Ikonen und Leitbildern der Protestbewegungen andererseits. Es wird ein grundsätzlicher Verzicht auf Idole und theoretische Ideengeber postuliert, die als Produkte der Konsumgesellschaft wahrgenommen werden. Dieses eigentümliche Paradox des Oszillierens zwischen der Ablehnung des Personenkultes und der Ikonisierung politischer und lebensweltlicher Vorbilder wird auch in Genets frühen politischen Reflexionen thematisiert und kennzeichnet somit seinen Eintritt in die gesellschaftspolitische Öffentlichkeit im Mai 1968. Die Unterstützung verschiedener revolutionärer Bewegungen mittels seines als Autor erworbenen Prestiges, wie sie unter anderem bei Benoît Denis als typisches Merkmal der intellektuellen Intervention beschrieben wird,1 bedingt die Furcht vor einer Instrumentalisierung seiner Person zu politisch-ideologischen Zwecken sowie vor der Defiguration seines Namens. Diese Problematik ist Gegenstand eines frühen journalistischen Kommentars über Genets Haltung zur Studentenrevolte von Mai 1968, der ein Interview mit Jean Genet im Rahmen seiner Einladung durch das comité d’agitation culturelleder Sorbonne beinhaltet.2 Das Aktionskomitee wurde am 13. Mai 1968 mit dem Ziel der Schaffung einer neuen Kultur gegründet und fordert von allen Kunstschaffenden die „auto-élimination“.3 Der Autor des in der Zeitung Combaterschienenen Artikels, Jean Lebouleux, betont in einem lobenden Kommentar, dass Genet sich des Versuchs der Instrumentalisierung seiner Person zu einem Idol der Studentenbewegung mit den Worten „[j]e ne veux pas être une idole, je suis un homme comme tout le monde“4 erwehrt. Genets Zurückhaltung während der Studentenunruhen wird sehr positiv aufgenommen, wie auch folgender Vergleich eines anwesenden Studenten mit Sartre belegt, der sich am 20. Mai im Auditorium der Sorbonne den Studierenden zum Dialog zur Verfügung gestellt hatte:5 „Sartre était un opportuniste, Genet est un poète.“6 Lebouleux kritisiert das Phänomen der Emblematisierung als einen der Konsumgesellschaft inhärenten Prozess: L’idole est un des produits de la société de consommation remise en question par les événements actuels. Il était donc normal que la révolution, si révolution il y a, supprime ce mythe.
Читать дальше