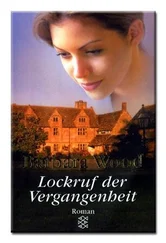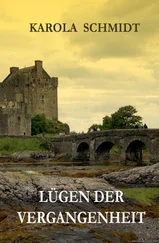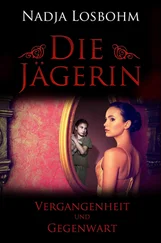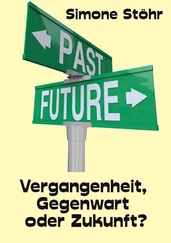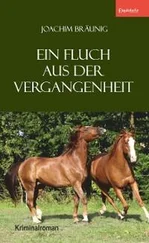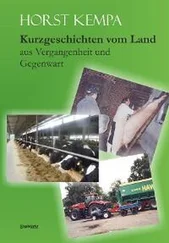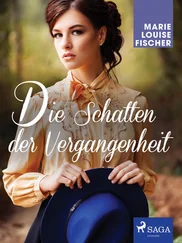Walser unterscheidet zwischen Gedächtnis und Erinnerung. Gedächtnis ist faktisch; es erfasst Einzelheiten, die etwas genau bestimmen (ein Lehrer stolpert im Klassenzimmer; der Pfiff eines Freundes; ein Bild an der Wand im Wohnzimmer), aber keine größeren Zusammenhänge herstellen. Walsers Skizze „Ein Jahr und das Gedächtnis“ setzt mit der Beobachtung ein: „Das Gedächtnis, unsere große Unfähigkeit: ein Haus, das unser eigen ist, aber wir haben nichts zu sagen darin.“20 Darauf folgen vorbeifliegende politische und gesellschaftliche Pressenachrichten und persönliche Eindrücke eines Jahres. An sie schließt die Frage an, ob das Ganze lediglich ein Angebot ist, aus dem sich das Gedächtnis nur aussucht, was ihm gefällt. Möglicherweise kann das Gedächtnis „Steine blühen lassen“ oder sich vertraut machen mit der endgültigen „Redaktion aller Communiqués.“ (267) Gedächtnis ist sicherlich in fiktiven Dokumentationen von Kriegserfahrungen stark mit Appellen an die Einfühlung der Leser verknüpft. Erinnerung dagegen ist gestaltetes Gedächtnis; sie stellt Assoziationen her, schafft Überblicke, vermittelt Einsichten, die auch anderen nachvollziehbar werden. Sie erweckt in Texten Sympathie; sie ist eine kritisch besonnene Rückschau. Erinnerung ist letztlich geistig literarisch. Sie ist das, was Hesse im Kapitel „Die Berufung“ ( Das Glasperlenspiel , 1943) schildert, wenn er darauf hinweist, Knecht habe in seinem Denken zwischen „legitimen“ und „privaten“ Assoziationen in der Gestaltung eines Spieles unterschieden. Zur Erläuterung führt der Erzähler das Beispiel eines abgeschnittenen Holunderblattes an. Der Geruch des Blattes zusammen mit der Erinnerung an ein Schubertlied „Die linden Lüfte sind erwacht“ ergibt eine Assoziationskette, die „Frühling“ ins Allgemeine, Typische erhöht.
Im dritten Kapitel der Novelle Ein fliehendes Pferd (1978) findet sich ein aufschlussreicher Hinweis auf die Walser ständig beschäftigende Ermittlung des Zusammenspiels von Gedächtnis und Erinnerung. Der Stuttgarter Studienrat Helmut Halm denkt über den plötzlich in seinem Leben aufgetauchten Klaus Buch und dessen Rekonstruktion seiner Vergangenheit nach. Der Erzähler stellt fest: „Helmut begriff allmählich, daß dieser Klaus Buch für einige ihm teure Jahre seines Lebens keine Zeugen mehr gehabt hatte. Und gerade aus diesen Jahren wollte er offenbar überhaupt nichts verlorengehen lassen. Zur Wiedererweckung des Gewesenen brauchte er einen Partner, der zumindest durch Nicken und Blicke bestätigte, daß es so und so gewesen sei. Ohne diesen Partner könnte er gar nicht sprechen von damals. Helmut sah, daß er es mit dem Kriegskameradenphänomen zu tun hatte. Er kannte diesen Wiedererweckungsfanatismus nicht. Jeder Gedanke an Gewesenes machte ihn schwer. Er empfand eine Art Ekel, wenn er daran dachte, mit wieviel Vergangenheit er schon angefüllt war.“21 Nach kurzem Nachdenken folgt der Satz: „Meistens wußte dieser Klaus Buch allerdings so genau Bescheid über das, was gewesen war, daß Helmut erschrak.“ (284) Helmut ist bestürzt und spürt Neid, weil sein Gedächtnis zwar mit Namen und Eindrücken angefüllt ist, aber keine erkennbare Form hat. Er kann das „Erzählbare“ nicht fassen. „Die Namen und Gestalten, die er aufrief, erschienen. Aber für den Zustand, in dem sie ihm erschienen, war tot ein viel zu gelindes Wort.“ (284) Für Klaus Buch dagegen lebt das Vergangene in einer „Pseudoanschaulichkeit“ auf, die alles Vergangene verleugnet und in plastischer Fülle vergegenwärtigt. „Bei Klaus Buch rollte es nur so von Tönen, Gerüchen, Geräuschen; das Vergangene wogte und dampfte, als sei es lebendiger als die Gegenwart.“ (285) Walser lässt der Sprache freien Lauf, um in einer Fülle von Eindrücken die formlose Vergangenheit im gegenwärtigen Gedächtnis festzuhalten und zugleich kritisch zu ironisieren. Demgegenüber versichert Jurek Becker 1997 in einem Interview, dass in seinem „Unbewußten“ Eindrücke des Vergangenen existieren. Aber auf die Frage, ob ihn seine Kindheit im Ghetto beeinflusst habe, antwortet er: „Das kann ich nicht sagen. Das müßte ein Psychiater rauskriegen. Ich habe keine Erinnerung daran. Ich kann Ihnen nichts über das Ghetto erzählen. Ich habe es vergessen – so als wäre es nie gewesen.“22 Er fährt fort mit der Feststellung, dass er sich zuerst intensiv mit der Vergangenheit beschäftigte, als er Material für seine Erzählungen sammelte. Dass die Konzentration auf Details, besonders wenn ein Autor alles „genaugenommen“ festhalten will, zu wuchern beginnt und die Gesamtdarstellung trüben kann, wird in der Erinnerungsdiskussion in Klaus Schlesingers Die Sache mit Randow (1976) deutlich. Die als Kriminalroman angelegte Erzählung beschreibt den Prozess gegen die Randow-Bande und den Mörder Randow. Sie verdeutlicht jedoch außerdem in detaillierten Einzelheiten das Leben in der DDR, fängt das Berliner Lokalkolorit und die damaligen Unterhaltungen der Einwohner ein und bietet viele lesenswerte Kurzporträts. Konkrete Hinweise auf die allgemeine Situation machen die Zeitumstände auch jungen Lesern verständlich, die der geschilderten Zeit bereits fernstehen.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Gegenwart ist eingehender in den Schilderungen von Maron, Ortheil und Hilbig. Im Erzählverfahren Marons wird deutlich, was auch die Erzählungen von Ortheil und Hilbig prägt und was bereits Soziologen wie etwa Maurice Halbwachs und Karl Mannheim in ihren Schriften feststellten: Die Erinnerung an Vergangenes wird von der gesellschaftlichen Umwelt mitbestimmt. Individuelle und kollektive Erinnerungen hängen von den zeitbedingten, zurückliegenden und gegenwärtigen Umständen ab. Dieser Sachverhalt tritt besonders deutlich in Marons Pawels Briefe hervor. Der konkrete Anlass der Suche nach der vergangenen und vergessenen Zeit ist die Umfrage eines holländischen Fernsehteams, das 1994 nach Berlin kommt, um die Haltung der Deutschen zur Vergangenheit zu dokumentieren. Die Autorin beginnt die Erzählung mit Fragen: Warum jetzt diese Geschichte schreiben? Die Lebensläufe gehören der Vergangenheit an. Wie entstand das Gefühl, sich „rechtfertigen zu müssen“? Warum etwas festhalten, das „wenig sicher ist“?23 Was ist Erinnerung? Wie ist sie beschaffen? „Erinnern ist für das, was ich mit meinen Großeltern vorhatte, eigentlich das falsche Wort, denn in meinem Innern gab es kein versunkenes Wissen über sie“. (8) Darüber hinaus erwägt Maron die Möglichkeit, dass das ganze Vorhaben ein Versuch sei, dem eigenen Leben Sinn zu geben oder es geheimnisvoll zu gestalten.
Die entstehende Familiengeschichte vermittelt Einblicke in das Leben von drei Generationen. Sie schildert die Herkunft, den Existenzkampf und den Tod des Großvaters Pawel Iglarz, eines zum Baptismus konvertierten Juden aus Polen, der sich mit seiner Frau Josefa in Berlin niederlässt, um dort als Schneider eine sorgenfreie Existenz aufzubauen; die Großeltern werden 1939 nach Polen ausgewiesen und kommen nach kurz befristetem Dasein im Ghetto im Konzentrationslager um. Die Geschichte beschreibt ferner die Kindheit der Mutter Hella und ihre Entwicklung zu einer überzeugten Kommunistin; sie erfasst das Aufwachsen und die kritische Meinungsbildung von Monika im Hause der Mutter und des Stiefvaters Karl Maron, des DDR-Innenministers von 1955 bis 1963. Das besondere Kolorit dieser alltäglichen Geschichten entspringt den Beobachtungen der Beteiligten, ihren Versuchen, das Geschehen zu verstehen, es selbst zu verklären, und der ständigen Befragung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Maron schildert die Auswirkungen des politischen Geschehens auf die Großeltern als ein von unkontrollierbaren Mächten gesteuertes Schicksal. Gleichzeitig bezweifelt sie die Vorstellung von undeutbaren Mächten und lehnt jeden Mythos des Vergangenen ab.
Читать дальше