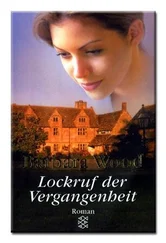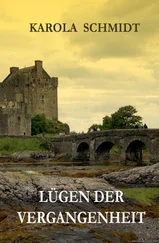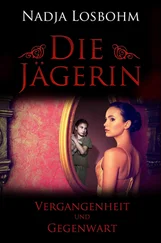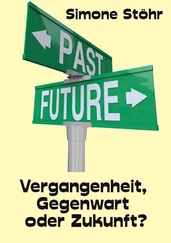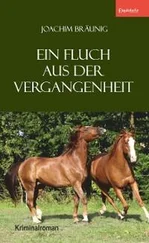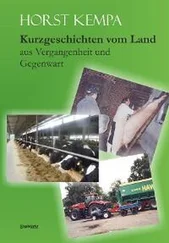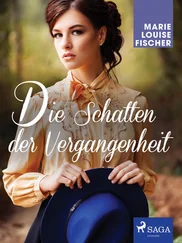Michael verfolgt den Prozess im Gericht. Alle wirken ermüdet. Richter, Schöffen und Anwälte sind nach langen Verhandlungswochen nicht mehr bei der Sache. Alle haben genug, wollen wieder in die Gegenwart (131). Michael erkennt das Ausmaß der Schuld, aber auch die Lebenslüge Hannas und stellt fest: „Mit der Energie, mit der sie ihre Lebenslüge aufrechterhielt, hätte sie längst lesen und schreiben lernen können.“ (132) Hanna wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Er liest wieder, schickt ihr Kassetten, bekommt dann Antwort, der er entnimmt, dass sie lesen und schreiben gelernt hat. Sie wird begnadigt; er erhält einen Brief der Leiterin des Gefängnisses, besucht Hanna, verspricht, sie abzuholen. Als er kommt, hat sie als Sühne Selbstmord begangen. In der Zelle findet er umfassende und vielseitige Holocaust-Literatur und ihr Testament: Michael soll ihre Ersparnisse und etwas Geld, das in einer lila Teedose ist, der Tochter der Frau übergeben, die mit ihrem Kind den Brand in der Kirche überlebte. „Sie soll entscheiden, was damit geschieht.“ (196) Michael findet die Frau in New York; sie behält die Teedose, das Geld wird im Namen Hannas an die „Jewish League Against Illiteracy“ überwiesen. Mit der kurzen „computergeschriebenen“ Antwort in der Tasche besucht Michael Hannas Grab, zum ersten und einzigen Mal.
Die Novelle „Das Mädchen mit der Eidechse“ greift in konzentrierter Form das dem Vorleser zugrunde liegende Thema der Vergangenheitsbewältigung auf.61 Der Erzähler schildert ein sein Leben von der Kindheit bis in die ersten Jahre des Jurastudiums bestimmendes Urerlebnis: die Wirkung eines Gemäldes. Das Bild ist der Angelpunkt der Erzählung. Es ist geheimnisumwittert. Die Eltern schweigen über seine Herkunft und die Identität des Künstlers. Es führt zu Spannungen zwischen den Eltern, wird vom Vater wie ein Schatz gehütet, von dem niemand wissen darf. Das Bild fasziniert, verzaubert den Jungen, wirkt geheimnisvoll und zugleich bedrohlich, weckt sein leidenschaftliches Interesse und lässt ihm keine Ruhe. Der Junge bemerkt, dass die Eltern etwas verschweigen und erkennt ihre Vorsicht im Umgang mit anderen. Er macht sich scheinbar keine besonderen Gedanken darüber, als der Vater als Richter abtritt, eine gering bezahlte Stellung bei einer Versicherung annimmt und schließlich jede Arbeit verliert, weil er zu viel trinkt. Der Versuch das Rätsel nach dem Tod des Vaters zu lösen, enthüllt zwar dessen Verstrickung in moralischer und juristischer Schuld im Krieg, lässt aber dennoch keine eindeutige Antwort zu. Der Vater hat als Kriegsgerichtsrat in Straßburg Menschen zum Tod verurteilt, hat möglicherweise das Gemälde von einem halbjüdischen Künstler als Geschenk erhalten, weil er der Familie zur Flucht verhalf, möglicherweise aber auch nur zur Aufbewahrung. Da sich aus den Nachforschungen des Sohns ergibt, dass sich in Straßburg jede Spur von dem Maler René Dalmann verliert, entsteht zusätzlich der Verdacht, der Vater habe sich vielleicht am Eigentum des Malers vergriffen, sei selbst für dessen Tod verantwortlich. Die Fragen bleiben unbeantwortet. Vom Vater liegt nur eine juristische Richtigstellung seines Falls vor. Der Sohn nimmt das Bild zu sich, kann sich jedoch nicht dazu durchringen, es einem Museum auszuliefern. Er verbrennt es am Strand und sieht noch für den Bruchteil einer Sekunde unter dem Bild das berühmteste in Ausstellungskatalogen und Kunstgeschichten erwähnte Gemälde des Malers, das er „hatte schützen und auf die Flucht mitnehmen wollen.“ (54) Der Schluss der Novelle stellt die Frage der Selbstverantwortung in grelles Licht: „Eine Weile schaute er den blauroten Flämmchen zu. Dann ging er nach Hause.“ (54)
Die Handlung in Das Wochenende ist auf Gespräche, Diskussionen, Behauptungen und scharfe Entgegnungen begrenzt. Der Anlass für das Treffen ist die Begnadigung des Terroristen Jörg. Seine Schwester hat auf dem Land in Brandenburg ein Haus gekauft, hat seine und ihre alten Freunde eingeladen, die hier Freitag, Samstag und Sonntag bleiben sollen, holt Jörg vom Gefängnis ab und bereitet mit ihrer Freundin den Empfang vor. Aus den Unterhaltungen aller wird deutlich, dass sich keiner richtig an die Tage der Studentenunruhen, Vietnam-Proteste und Anschläge gegen den Staat (die Machthaber und ihre Bürokraten) erinnern kann. Sie leben in einer anderen Zeit, haben Karriere gemacht und sich abgefunden. Sie haben sich von der Vergangenheit losgesagt, haben sich ihre „Sünden“ vergeben und dadurch von der Last der Gemeinschaftsschuld befreit. Sie erinnern sich an die Atmosphäre, die nächtelangen Diskussionen, Planungen, Vorbereitungen auf Taten. Sie wollten „selbstlos denkend“ die Welt verändern. Der Staat war ein Unrechtsstaat und Widerstand ohne Gewalt war undenkbar.62 Die nächste Generation kommt in der Auseinandersetzung zwischen Jörg und seinem Sohn Ferdinand zu Wort. Ferdinand verlangt eine Erklärung für die Aktionen, die schuldlosen Menschen das Leben kostete. Er besteht eigentlich auf einem Geständnis der Schuld. Er sieht sich in der Rolle des Sohnes, der den Vater anklagt, und als Stellvertreter der mit ihm befreundeten Kinder eines ermordeten Bankchefs. Er donnert: „Du bist zur Wahrheit und zur Trauer so unfähig, wie die Nazis es waren. Du bist keinen Deut besser – nicht als du Leute ermordet hast, die dir nichts getan haben, und nicht als du danach nicht begriffen hast, was du getan hast. … Dir tun nicht die anderen leid, du tust dir nur selbst leid.“ (159) Der Vater sitzt vor ihm mit aufgerissenen Augen und halboffenem Mund. Er kann sich an nichts erinnern. Am Ende resigniert Ferdinand. Er erkennt, dass sich sein Vater von seiner Vergangenheit losgesagt hat, nichts mehr weiß oder wissen will und auch das Leben in der Gegenwart nicht begreift.
Der Blick trifft auf Studentenunruhen, die Jahre der DDR, den Krieg und die Nazi-Herrschaft, Perioden der deutschen Geschichte, die einem unbereinigten Minenfeld ähneln, in dem man leicht zu Schaden kommt. Berlin und Auschwitz sind politische und literarische Chiffren für Abschluss und Neuanfang, für individuelle Schuld, kollektives Schuldgefühl und Unterlassungssünden. Köln, Dresden und Gulag sind Chiffren für Leiden, Klage und Opfer. Die Besinnung auf die Vergangenheit enthüllt sich als potentieller Gewinn für das Verständnis der Gegenwart. Die Haltung aller Autor(inn)en, die sich bemühen, das historische Geschehen zu begreifen, steht unter dem Leitspruch: Beschäftigung mit der Vergangenheit ist Tagespflicht.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.