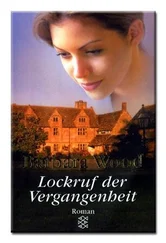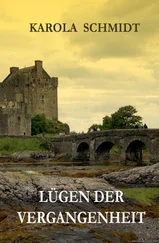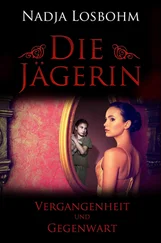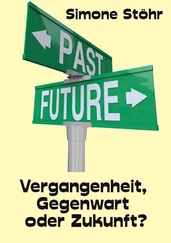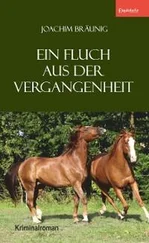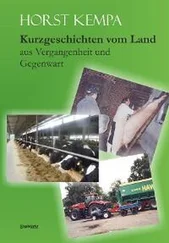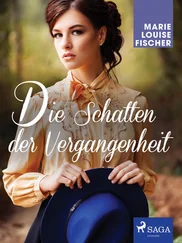In anderen Romanen und Erzählungen wird eine Einstellung deutlich, welche die kollektive Schuld und die Verfehlung Einzelner nicht einseitig anprangert, sondern aus distanzierter Sicht die Schuldfrage erwägt. Dieses Anliegen bedingt ein Erzählverfahren, in dem das Unfassbare zu Wort kommt. Darüber hinaus verlangt die literarische Gestaltung dieser Problemstellung eine Auseinandersetzung sowohl mit den Gefühlen der Generation Jugendlicher, die das Dritte Reich noch miterlebt haben, aber überzeugt sind, persönlich unschuldig zu sein, als auch mit der Einstellung der nach dem Krieg geborenen Menschen, die sich gegen den Generalverdacht wenden, dass sie als Deutsche mitverantwortlich für die Vergangenheit sind und den Vorwurf der Schuld und Schande ablehnen. Von wesentlicher Bedeutung ist die charakteristische Nuancierung in den Erzählungen, die bei allen Gemeinsamkeiten unterschiedliche Deutungen zulässt. Vergleicht man beispielsweise die Aufarbeitung der Vergangenheit in Peter Schneiders Roman Eduards Heimkehr (1999) mit Jurek Beckers Bronsteins Kinder (1986), so ergeben sich bei vergleichbarer Fragestellung erhebliche Unterschiede.
Schneider wählt Berlin als Handlungsraum. Der Ort, Hauptstadt des Dritten Reiches und der DDR, zehnjährige Wiederkehr des Mauerfalls, neue Hauptstadt Deutschlands, bietet die Voraussetzung für eine Fixierung auf die deutsche Vergangenheit. Der Handlungskern ist jedoch eine alltägliche, fast banale Geschichte. Eduard erhält eine Stellung in Berlin, kehrt aus den USA heim, muss seine Frau und Kinder nachholen und eine Wohnung für die Familie finden. Die Erzählung schildert häufig erörterte alltägliche Probleme moderner Ehen, die im konkreten Fall durch die Umsiedlung profiliert werden. Von zentraler Bedeutung ist Eduards Verhältnis zu seiner deutsch-jüdischen Frau. Dieses wird maßgebend bestimmt von seinem Beziehungswahn, der ihn zwingt, die alltäglichsten Ereignisse aus der Sicht seines Deutschtums und dadurch im Licht seiner deutschen Vergangenheit zu sehen.
Eduards Erinnerungen führen zu ständigen Beziehungskrisen und vermitteln den Eindruck, dass die Vergangenheit nicht bewältigt ist. Auch die Menschen, denen Eduard begegnet, neue Kollegen und alte Bekannte, leben in einer „ewigen Nach-der-Wende-Zeit und Nachkriegszeit“. Dieser Sachverhalt tritt deutlich hervor in ständigen Debatten und Reibungen zwischen Ossis und Wessis, Ossis, die dageblieben sind und Ossis, die nach dem Westen abwanderten, und zwischen all den Gruppen, die sich in der DDR gebildet hatten. Der versöhnliche Schluss des Romans kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vergangenheit immer gegenwärtig ist und die Grundlage quälender Erinnerungen bleibt.
Ganz ähnlich präzisiert Wolfgang Hilbig das Schuldbewusstsein in Gedichten wie etwa „deutscher morgen“, „alibi“ und „grober rückfall“, in denen die Vergangenheit als unerledigte, unvollkommene Dokumentation erscheint. Die Abrechnung im Gedicht „nach dem zweiten / krieg“ erfasst das Fortbestehen des Alten in der zeitlichen Veränderung:
nach dem zweiten
krieg vergaß man beim aufräumen
einige vokabeln
aus der welt zu schaffen.
noch immer nicht
sind aus der deutschen sprache verbannt
wörter wie
unverbrüderlich
unzertrennlich
uneinnehmbar
unbesiegbar.55
Jurek Becker verfolgt in der souverän gestalteten Erzählung Bronsteins Kinder (1986) die Spuren, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart führen und in der Lösung der Konflikte die Möglichkeit des Vergebens andeuten. Die vorsichtige Sondierung des Gegenwärtigen und Gestrigen erfolgt aus der Sicht des jüdischen Schülers Hans. Becker schildert einen grundlegenden Ausschnitt aus dem Lebensweg von Hans, indem er multiperspektivisch gebrochene, gegenwärtige Erfahrungen und Erinnerungsmuster entwirft, die deutsch-jüdische Beziehungen, den Konflikt zwischen Rechtsstaat und Willkür und Vergeltung und Vergeben objektivieren. Das Zusammenwirken von Individuellem und Gesellschaftlichem wird deutlich in dem scharf profilierten Handlungsverlauf. Der Vater und zwei seiner Freunde nehmen den ehemaligen Lageraufseher Arnold Heppner gefangen, binden ihn in einem Sommerhaus fest, verhören ihn und verlangen ein Geständnis seiner Schuld. Hans überrascht die Gruppe und versucht, seinen Vater von dem widerrechtlichen Handeln zu überzeugen. Er selbst denkt über vergangene Willkür, das Unrecht, die Opfer des Faschismus und die gegenwärtige Situation nach. Er besucht den Gefangenen und ringt sich schließlich zu dem Entschluss durch, den Lageraufseher zu befreien. Er kauft Feilen, um die Fesseln zu beseitigen, kommt nach Hause, wo er den am Herzschlag verstorbenen Vater findet, führt aber seinen Plan durch und befreit Heppner. Hans wird von Freunden des Vaters, Rahel und Hugo Lepschitz, aufgenommen und lebt mit ihnen 1973 bis 1974. Er besteht das Abitur, wird zum Studium zugelassen und hofft auf eine Zukunft, in der die Vergangenheit endlich bewältigt ist.
Die Darstellung ist konzentriert auf den geistig-seelischen Prozess der Selbstfindung, der in der Auseinandersetzung mit der Familie, der Gesellschaft und der Vergangenheit zu einer höheren Stufe der Selbsterkenntnis führt. Zwischenmenschliche Beziehungen werden erschwert durch die Reaktion der Umwelt auf die „jüdische Frage“ und durch die konkrete Situation des Sohnes, der mit seinem Vater lebt – die Mutter ist verstorben, die Schwester lebt in einem Krankenheim – und die Welt aus eigener und dessen Sicht erlebt. Der Vater ist verschlossen. Kleine Missverständnisse erschweren das tägliche Leben. Hans stellt fest: „Ich hörte ihn seufzen und wollte etwas Tröstliches sagen, doch als ich mich umdrehte, saß er nicht mehr da. So war es immer: immerzu war einer gekränkt, immerzu mußte der andere sich plagen, das Elend wieder aus der Welt zu schaffen.“56 Hans steht den oft gehörten Erzählungen des Vaters „kühl und skeptisch“ gegenüber und findet, er sei unwillig den Umschwung im Denken der jungen Generation zu verstehen. Hans ist beliebt in der Schule, aber wird anders, vorsichtiger behandelt, sobald man weiß, dass er Jude ist. Ein Vorfall im Duschraum, wo Hans seine Badehose nicht auszieht, belegt, dass auch er sich zuweilen als Außenseiter sieht. Positive und negative Vorurteile bestehen fort. Die Freundin Martha findet Arbeit als Komparsin und spielt eine Jüdin mit gelbem Stern. Sofort findet man, sie sehe „echt“ jüdisch aus. Die Komparsen sitzen in Pausen als Gruppen: die SS-Soldaten zusammen und gegenüber die Juden nebeneinander. (196ff.) Die Gefangennahme des Lageraufsehers und die Diskussionen der Beteiligten veranschaulichen die nahezu unüberbrückbaren Vorstellungen vom gegenwärtigen Staat. Hans ist sicher, dass jedes Gericht den Mann ohne Sympathie und aus Überzeugung verurteilen werde. Der Vater dagegen glaubt, der Aufseher wird nur verurteilt, weil „ihnen nichts anderes übrigbliebe.“ (129) Hans kämpft gegen die Unvernunft, findet die Opfer haben kein Recht, sich über die Gesetze zu stellen, und fürchtet sich, in einem Land zu leben, in dem sich jeder selbst zum Richter ernennt. (136–140) Aber er erkennt die ständige Gereiztheit der überlebenden Juden. Ihre Vorstellung vom Deutschtum war literarisch und philosophisch gefärbt. Die Wirklichkeit entsprach nie und entspricht auch jetzt nicht dem Ideal.
Pascal Bruckner kommt in seiner ausführlichen und überzeugenden Untersuchung des weitverbreiteten Schuldgefühls in der westlichen Welt zu einem vergleichbaren Ergebnis. Er findet, Schuldkomplexe entspringen der Überzeugung, dass der Verlauf historischer Entwicklungen nicht der Idealkonzeption gesellschaftlicher Reifung entspricht. Die Vorstellung eines Ablaufs der Geschichte in die Richtung höherer Sittlichkeit verurteilt alle, die an den Fehlentscheidungen des 20. Jahrhunderts beteiligt waren. Darüber hinaus verurteilt dieser Wertmaßstab die gegenwärtige Generation zum Schweigen.57 Bernhard Schlink hat sich in Essays und Vorträgen mehrmals eingehend mit der Vergangenheit, mit Schuld und Sühne auseinandergesetzt. Er hat die angeschnittenen Fragen außerdem überzeugend in einigen Erzählungen entwickelt. Da Schlink Jurist ist, kommt seinen Feststellungen der gesetzlichen Verantwortung für Straftaten besondere Bedeutung zu. Wie viele in der vorliegenden Darstellung aufgenommenen Kritiker und Autor(inn)en ist er überzeugt davon, dass Auschwitz und der Holocaust unter dem Zeichen der Unvergänglichkeit stehen. Die Katastrophe, in der die Grenze zwischen Gut und Böse eindeutig war, hat Wunden gerissen, die schwer zu heilen sind und „wieder aufbrechen können“. Schlink geht davon aus, dass sich alle mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen müssen, um einen Weg zum Geschichtsverständnis zu finden. „Der Vergangenheit in die Augen sehen – das heißt sehen, daß die Vergangenheit uns anschaut, uns stellt und daß wir ihr furchtbares Angesicht letztlich nur ertragen können, wenn wir entweder gleichgültig und zynisch werden oder aber etwas entgegenzusetzen haben. Letztlich heißt, der Vergangenheit in die Augen sehen, eine Entscheidung treffen. Zunächst heißt es, die Herausforderung ihres furchtbaren Angesichts annehmen.“58 Dieses Gegenübertreten verlangt die Auseinandersetzung mit Schuld und Sühne.
Читать дальше