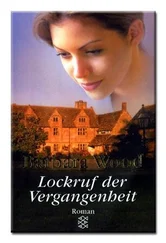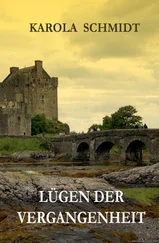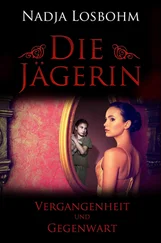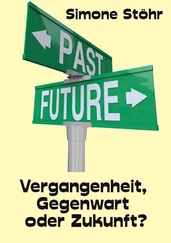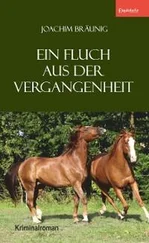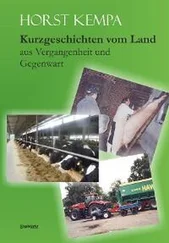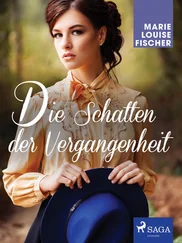Der Erzähler Paul Pokriefke kommt am 30. Januar 1945 zur Welt. Die „dramatisch-alltägliche“ Geburt, Minuten nachdem seine hochschwangere Mutter von dem torpedierten Schiff „Wilhelm Gustloff“ gerettet wurde, verknüpft sein Leben mit der Gustloff-Legende. Sein Vater bleibt unbekannt; die Mutter hat ihn vergessen, will nicht über ihn sprechen und verwechselt ihn möglicherweise mit einem anderen Mann. Paul wächst in der DDR auf, setzt sich aber nach Westberlin ab und studiert Germanistik. Er wird von seinem „möglichen“ Vater finanziell unterstützt und arbeitet als Journalist für Springers „Morgenpost“. Paul verfertigt Sachberichte und schreibt über alles, auch über „Nie wieder Auschwitz“, aber nie über die „Gustloff“, denn das Thema war jahrelang nicht diskussionswürdig. Paul heiratet und hat einen Sohn. Seine Frau trennt sich von ihm und zieht mit dem Sohn Konrad in den Westen. Nach der Scheidung betrachtet sich Paul als „lebensversehrten“ Versager.
Die Mutter, Konrads Großmutter, Ursula (Tulla) Pokriefke ist eine Virtuosin der Anpassung an politische und gesellschaftliche Umstände. Sie überlebt; ist zufrieden und voller Widersprüche, die sie selbst nicht empfindet. Sie erinnert sich an die Nazizeit, die „gute Seiten“ hatte und denkt mit Freude an die „schöne“ Fahrt auf dem KDF-Schiff „Gustloff“. Sie wird Tischlerin und Leiterin einer Tischlerbrigade in der DDR. Sie ist überzeugte Kommunistin und zündet eine Trauerkerze an, als Stalin stirbt. Trotzdem macht sie keine Schwierigkeiten, als sich Paul nach Westberlin absetzt. Sie hat außergewöhnlichen Einfluss auf Konrad und vermittelt ihm Ansichten über die Vergangenheit, die der Erzähler als „das unbeirrbare Gequassel des Ewiggestrigen“ charakterisiert. Aber Tullas Gerede, das ihre enge Verflechtung mit dem Schiff, der Torpedierung und der Schiffslegende herausstellt, beeinflusst nachdrücklich Konrads Leben. Als Konrad (Konny) seine Großmutter nach dem Mauerfall in Schwerin besucht, erzählt sie ihm erregende Geschichten aus der Vergangenheit.
Für Konrad lebt die Vergangenheit nicht nur auf, er will sie rehabilitieren. Nachdem ihm Tulla einen Computer schenkt, konzentriert er sich auf den Fall Gustloff, den er „richtig stellen“ muss. Durch sein unablässiges Bemühen wird „Gustloff“ eine Internet-Sensation. Die Berichterstattung schließt ein: Stapellauf, Lobesreden, Nachrichten über Robert Ley, Urlauber- (Kraft durch Freude), Lazarett-, Ausbildungs-, Truppentransport- und schließlich Flüchtlingstransportschiff, Torpedierung durch ein russisches U-Boot, dessen Kapitän Alexander Marinesko kurz erwähnt wird, und schließlich Erinnerungsfeiern der Überlebenden. Währenddessen debattieren zwei junge Menschen auf der Website www.blutzeuge.dealle mit dem Untergang der „Gustloff“ verknüpfbaren Gedanken. Ihre Meinungen sind hart, kompromisslos und unvereinbar. Konny vertritt die Ehre deutscher Vergangenheit; sein Gesprächspartner David ist Fürsprecher des Judentums und versucht, Konnys Ansichten zu widerlegen. Paul verfolgt die Debatten und erkennt, dass sein Sohn der „schiffskundige“ Germane ist, beurteilt aber das Schreiben Konnys als „harmlos kindisches Zeug, das er als Cyberspace-Turner von sich gab“ (88). Er erkennt auch hinter Konnys Feststellungen das Gerede Tullas. Was er nicht erwartet, was niemand ahnt, ist das unerhörte Ereignis der Novelle. Konrad schlägt David vor, sich zu treffen. Er erschießt David bei der Begegnung am 20. April 1997. Er handelt aus innerer Notwendigkeit: Die Stimme des Feindes muss zum Schweigen gebracht werden. Das Gerichtsverfahren ergibt, dass David eigentlich Wolfgang heißt, kein Jude ist, aber alles Jüdische hoch verehrt. Er leidet unter schweren Schuldvorstellungen und verlangt Sühne vom deutschen Volk. Er hat kein Verständnis für die Meinung seiner Eltern, die finden, „irgendwann müsse Schluß sein mit den ewigen Selbstanklagen.“ Dieser Sachverhalt ändert Konnys Meinung nicht. Er wird mit 7 Jahren Jugendhaft bestraft. Die Eltern können Konrad nicht verstehen. Dagegen debattieren andere die Schuldfrage weiterhin auf einer neuen Webseite Kameradschaft-konrad-pokriefke.de. Sie kennzeichnen seine Haltung als vorbildlich.
Was bleibt: eine unabgeschlossene Auseinandersetzung, an der jede Generation mitwirkt und in der alle ihren Erfahrungshorizont erweitern. Die Gegensätze bestehen fort. Die Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen, stößt auf das ständige Bemühen, die Vergangenheit zu begreifen.
2. Vergangenheit: Erinnern – Wiederherstellen – Deuten
2.1. Wahrnehmung, Gedächtnis, Erinnerung, Retrospektive
Fragen der Begriffsbestimmung von Wahrnehmung, Gedächtnis und Erinnerung führen in Literatur und Kritik seit 1945 zu theoretischen Ermittlungen und Überlegungen, die im Handlungsverlauf von Erzählungen anklingen. Die Problematik eine wie auch immer ausgeprägte Realität sprachlich ausdrücken zu können, führt zuweilen dazu, theoretische Ansätze aus den Geisteswissenschaften in literarische Texte einzubauen oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse unbefragt zu übernehmen. Die in den vorliegenden Ausführungen besprochenen Autor(inn)en stimmen darin überein, dass jede Wahrnehmung auf der bewussten und auch unbewussten Aufnahme von sinnlichen und geistigen Eindrücken basiert. Die Eindrücke werden sinnvoll zu einer Wahrnehmungseinheit gestaltet und im Gedächtnis bewahrt.14 Die Wahrnehmung wurzelt in Erleben, Handeln, Betrachten und Reflektieren. Jedes Erleben erfasst eine sinnliche und geistige Reaktion auf das, was uns in Natur und Gesellschaft umgibt und auch auf Ereignisse im Leben. Das Handeln kann in instinktiven Reaktionen gründen, die besonders in der Kriegsthematik geschildert werden. Der Begriff kennzeichnet jedoch ferner jedes bewusst überlegte Verhalten zur Umwelt und bildet die Voraussetzung zu möglicher Selbst- und Welterkenntnis.15
Das Gedächtnis ist sowohl individuell als auch kollektiv eingefärbt. Es erfasst den Augenblick des Geschehens, die Zeitspanne eines Eindrucks, die konkrete Reaktion auf eine Begebenheit und die festgehaltene Sensation, welche unterschiedliche Sinneseindrücke zu einer Einheit verschmilzt. Die gespeicherten und geordneten Eindrücke initiieren außerdem bewusste Lernprozesse. Der Vorgang beeinflusst die Bewusstseinslage von Individuen und Figuren in Texten und schafft die Voraussetzung für die unterschiedlichsten literarischen Gestaltungen. Beispielsweise erfährt der Erzähler, ein Physiker, in Christoph Aigners Anti Amor (1994), wie komplex abgründig jede Wahrnehmung ist. Sein Gegenspieler, Theseider, reduziert die ideelle, ideale klassische Liebesvorstellung und sittliche Neigung auf rein biologische Vorgänge. Beide bezweifeln schließlich jede Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis. Scharfsinn und Spekulation, Phantasie und Wahn stehen zuletzt gleichberechtigt nebeneinander in der im Text postulierten immer „werdenden und vergehenden Welt.“16
Ein in der Erinnerung kritisch beleuchteter Eindruck kann tradierte oder kollektive Vorstellungen übernehmen und das Ereignis zu einer neuen, authentisch wirkenden Einheit verbinden. Dieser Vorgang führt zu Verunsicherungen in Tatsachenberichten und Aussagen von Augenzeugen. Er ist Ausgangspunkt für Erkundungen zahlreicher Autor(inn)en in Bestandsaufnahmen der Vergangenheit. Darüber hinaus beleuchten die Realismus-Diskussionen (sozialistischer, klinischer, magischer Realismus) und die Literaturkrisis-Debatten das Wechselverhältnis von Stileigenheiten und Wahrnehmung, Erinnerung und politischen oder ästhetischen Überzeugungen.17 Augstein und Walser versuchten 1998 in einem kritischen Gespräch die Beschaffenheit der Erinnerung zu bestimmen. Ihr Meinungsaustausch „Erinnerung kann man nicht befehlen. Martin Walser und Rudolf Augstein über ihre deutsche Vergangenheit“18 verdeutlicht in Feststellung, Frage und Gegenfrage, wie beide im Rückblick ihr Handeln und ihre Unterlassungen häufig so deuten, dass sie ihrem gegenwärtigen Erfahrungshorizont entsprechen. Beide suchen die Wahrheit, unterbrechen aber ihre Beobachtungen durch kritische Einwände, in denen deutlich wird, dass nicht alles so verlaufen sein kann, wie sie es in ihrer jetzigen Erinnerung im Gedächtnis haben. Beispiele: „Walser: Bist du sicher? … Das halte ich für die nachträgliche Inszenierung eines Films. Augstein: Ich weiß es noch. Sonst hätte es sich mir ja nicht eingeprägt. … Walser: Und das hast du dir gemerkt? Da warst du erst zehn.“ Walser fasst nach: „Das hast du nicht gesagt, jetzt verklärst du irgend etwas. … Du wußtest doch nicht, wer Lovis Corinth ist und daß man die Bilder verkaufen muß. Gib zu, das hat dein Vater gesagt, Rudolf!“ Augstein betont die Ablehnung Hitlers in seiner Familie, die politisch wach erscheint; darauf Walser: „Du bist gleich auf der SPIEGEL-Seite der Welt geboren worden. … Rudolf, du bist wirklich der beste, schönste, liebenswürdigste, ungefährdetste Roman …, den ich je gelesen habe. … Mit der Wirklichkeit kann es nichts zu tun haben.“ Darauf Augstein: „Es ist erlebte Wirklichkeit, nicht geschönt.“ Walser ist überzeugt davon, dass jeder bewusste Rückblick die Vergangenheit verändert. Das Gespräch weist hin auf die Problematik „falscher“ Erinnerungen, die subjektiv als wahr, untrüglich, wirklich empfunden werden, aber objektiven Tatsachen widersprechen.19
Читать дальше