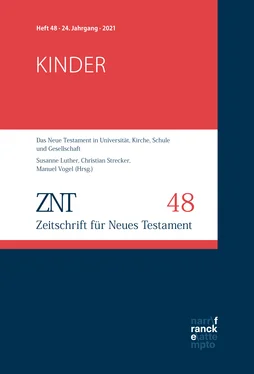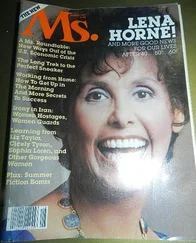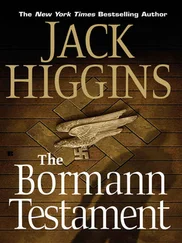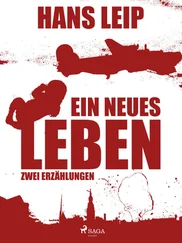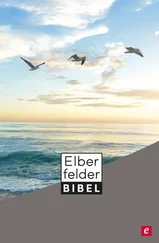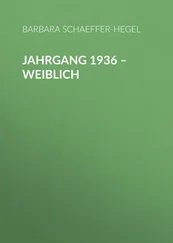7.2 Evangelien und die Apostelgeschichte
In dem von Marcia J. Bunge herausgegebenen Band von 2008 finden sich Beiträge zu den einzelnen Evangelien, ebenso in einigen Aufsätzen in verschiedenen Monografien. Die umfangreichste und systematischste Darstellung hat Sharon Betsworth vorgelegt (2015), mit Kapiteln zu jedem der kanonischen Evangelien.1 Sie betrachtet die Evangelien aus soziohistorischer, redaktionskritischer, literarischer und gendertheoretischer Perspektive.2
Bislang sind drei Monographien zu den synoptischen Evangelien erschienen, die früheste von Bettina Eltrop über Matthäus (1996) zu sämtlichen mt. Passagen, die von Kindern handeln, detailliert zu 18,1–5 und 19,13–15.3 Ihr Ansatz ist soziohistorisch und feministisch, mit hermeneutischen Überlegungen. Die feministische Perspektive auf Matthäus wird außerdem von Sharon Betsworth in einem Buchkapitel weiterverfolgt.4
Die zweite von Betsworth vorgelegte Monografie,5 nun zum MkEv (2010), konzentriert sich auf die Rolle der Töchter, vergleicht die Texte mit den Einstellungen gegenüber Mädchen in griechisch-römischen Quellen und in der Septuaginta und zeigt, dass Markus damit teils übereinstimmt, teils auch davon abweicht, und zwar auf eine Weise, die dazu dient, seine Vorstellungen über das Reich Gottes zu pointieren. Die Artikel von Melanie A. Howard und Anna Rebecca Solevåg befassen sich mit Kindern in Wundergeschichten bei Markus, einem Jungen (9,14–29) und einem Mädchen (7,24–30). Beide analysieren die Texte aus der Perspektive der disabilitiy studies .6
Das dritte und jüngste Buch (2019) zum LkEv hat Amy Lindeman Allen publiziert. Sie liest die Texte eingehend aus einer kindzentrierten und kindlichen Perspektive, auch mit einem hermeneutischen Interesse an den vielfältigen und aktiven Rollen von Kinder im Evangelium, etwa als Jünger Jesu und als Hörer und Täter von Gottes Wort.7 John T. Carroll gibt einen Überblick über das lukanische Material, und Nils Krückemeier und Bradly S. Billings konzentrieren sich auf die Passagen über den Jesusknaben im Tempel (2,41–52), mit besonderem Augenmerk auf den literarischen und soziohistorischen Kontext.8 Die Wahrnehmung von Kindern im synoptischen Spruchgut (Q) wurde außerdem in einer Reihe von Artikeln von A. James Murphy diskutiert.9
Angesichts der fast unsichtbaren Stellung von Kindern im Johannesevangelium ist es nicht verwunderlich, dass hierüber nur wenig geschrieben wurde. Eine Ausnahme bilden die Aufsätze von Marianne Meye Thompson und Joachim Kügler, jedoch mit Blick auf den metaphorischen Rekurs auf „Kinder“ bei Johannes.10 Zur Apostelgeschichte liegen nur wenig Studien vor, obwohl Kinder dort einen sichtbareren Platz einnehmen als bei Johannes, freilich weniger als im LkEv. Joel B. Green gibt immerhin einen Überblick über die relevanten Passagen und erörtert die Relevanz des Materials für eine Theologie der Kindheit.11 Gelegentlich geht auch Diane G. Chen in ihrer Analyse von Gott als Vater in der Apostelgeschichte auf Kinder ein, sei es in einem realen oder metaphorischen Sinn.12
7.3 Briefe und Offenbarung
Die Paulusbriefe und die Briefe der paulinischen Tradition sind relativ ausführlich behandelt worden, vor allem aus theologischer und soziohistorischer Sicht. Von Beverly Roberts Gaventa und mir selbst gibt es kurze Übersichten und Diskussionen über die sieben unbestrittenen Paulusbriefe. Gaventas Beitrag befasst sich mit der modernen Relevanz, der meinige mit der rhetorischen Funktion.1 Beide untersuchen u. a. Paulus‘ Verwendung von einschlägigen Metaphern, ein Thema, das die Forschung auch sonst beschäftigt.
Christine Gerber (2005) und Trevor J. Burke (2003) behandeln in monographischem Umfang Eltern-Kind-Metaphern, Gerber in eingehenden Analysen von Passagen aus verschiedenen Briefen, Burke speziell zu 1Thess.2 Ebenfalls monographisch befassen sich Gaventa (2007) und Jenifer Houston McNeel (2014) mit Mutter-Kind-Metaphern, erstere bei Paulus, letztere zu 1Thess.3 Alle diese Studien bedienen sich metapherntheoretischer und soziohistorischer Ansätze, wobei sie der rhetorischen und theologischen Funktion des Materials große Aufmerksamkeit widmen. Viele von ihnen konzentrieren sich auch auf den hierarchischen Charakter der Eltern-Kind-Beziehung. Im Vergleich zu den umfangreichen Forschungen zu paulinischen Familien- und Kindheitsmetaphern ist die Forschung zur Stellung der Kinder bei Paulus und in seinen Gemeinden eher dürftig. Der Mangel an solchen Studien ist wahrscheinlich der marginalen Rolle von Kindern in den Paulusbriefen geschuldet, mit 1Kor 7,14 als der einzigen ausdrücklichen Erwähnung ist, und dies auch nur am Rande; in einem Buchkapitel befasst sich Judith M. Gundry immerhin mit dieser Stelle.4
Ganz anders als in den sieben authentischen Briefen werden Kinder in den deuteropaulinischen Briefen (Eph, Kol und 2Thess) und den Pastoralbriefen (1–2Tim und Titus) an vorderster Stelle genannt, vor allem in den Haustafeln (z. B. Kol 3,18–4,1; Eph 5,21–6,9) und ähnlichen Texten, aber auch in verstreuten Ermahnungen zum verantwortungsvollen Umgang mit Kindern (z. B. 1Tim 5; Tit 2,4). Margaret Y. MacDonald hat die umfangreichste und systematischste Analyse dieses Materials vorgenommen (2014).5 Ihr Schwerpunkt liegt auf der Wahrnehmung von Kindern und Kindheit sowie auf den sozialen und religiösen Funktionen von Kindern in der Familie und in den Hauskirchen. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Identitätskonstruktion und -bildung und zeigt die komplexen familiären und gesellschaftlichen Muster auf, in die Kinder eingebettet waren. Carolyn A. Osiek, Janet H. Tulloch und Margaret Y. MacDonald befassen sich in ihrem Band über Frauen im frühen Christentum (2006) ebenfalls mit diesem Material und widmen Kindern, insbesondere Mädchen, besondere Aufmerksamkeit.6
In den katholischen Briefen (Jak; 1–2 Petr; 1–3 Joh; Judas) und im Hebräerbrief geht es um Kinder vor allem in metaphorischer Sprache, wenn die Gläubigen als Kinder angesprochen oder als Kinder Gottes charakterisiert werden, oder wenn Bilder aus dem Bereich der Kindheit Verwendung finden (z. B. Hebr 5,13; 1Petr 1,14; 1Joh 2; 2Joh 1). James M.M. Francis sowie Horn und Martens haben sich neben anderen kurz mit diesem Thema beschäftigt.7
Für die Offenbarung des Johannes, in der Kinder und Kindheit nur eine marginale Rolle zu spielen scheinen, gibt es nur wenige Arbeiten, mit Ausnahme eines Artikels, in dem Betsworth die Offenbarung aus der Perspektive von Kindern betrachtet.8
7.4 Einige weiterführende Überlegungen
In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Forschung über Kinder und Kindheit im Neuen Testament recht umfangreich geworden. Die Forschungen sind jedoch sehr ungleichmäßig verteilt, wobei den synoptischen Evangelien und den Briefen des Paulus und der paulinischen Tradition die größte Aufmerksamkeit zuteilwurde. Das Johannesevangelium, die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe sind nur in begrenztem Umfang erforscht worden, die Offenbarung des Johannes nur sehr wenig. Der Schwerpunkt lag häufig auf der Familie, den Generationenhierarchien und der bildhaften Familiensprache, und zwar zunehmend mit einer Perspektive „von unten“. Eine Vielzahl von Methoden wurde auf das Material angewendet: sozio-historische, feministische/geschlechtsspezifische, metapherntheoretische und begrenzt auch lingusitische Lektüren. Auch andere Ansätze gewinnen zunehmend an Bedeutung, wie im Folgenden erläutert wird.
Einige bisher wenig beachtete Bereiche sind hier zu notieren. So sollte beispielsweise die Einstellung des historischen Jesus zu Kindern und zur Kindheit näher untersucht werden. Die traditionelle und weit verbreitete Vorstellung, Jesus sei besonders kinderfreundlich gewesen, ist bisher kaum diskutiert oder gar problematisiert worden, mit Ausnahme des genannten Buches von Murphy. Das Thema ist sowohl historisch, theologisch und hermeneutisch von Bedeutung: Zum einen kann es Auswirkungen auf die vielfach hohe Wertschätzung von Kindern im christlichen Denken haben, zum anderen aber auch auf etablierte Vorstellungen von Jesus. Ein nicht so kinderfreundlicher Jesus könnte aus christologischer Sicht durchaus beunruhigend wirken.
Читать дальше