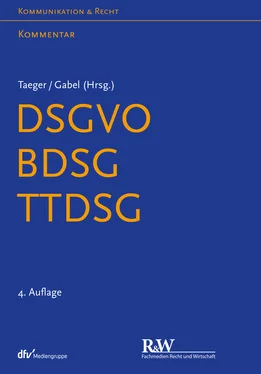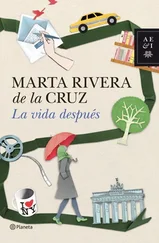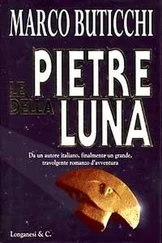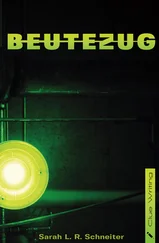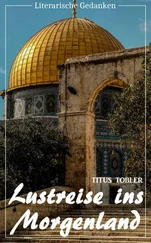490
Die federführende Aufsichtsbehörde kann sich dem maßgeblichen und begründeten Einspruch anschließen. Tut sie dies nicht oder ist sie der Ansicht, dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht begründet ist, leitet sie gemäß Art. 60 Abs. 4 DSGVO ein Kohärenzverfahrenein. Der Europäische Datenschutzausschuss erlässt daraufhin gemäß Art. 65 Abs. 1 lit. a DSGVO einen für sowohl die federführende als auch alle betroffenen Aufsichtsbehörden verbindlichen Beschluss über alle Fragen, die Gegenstand des maßgeblichen und begründeten Einspruchs sind.
2. Merkmale eines maßgeblichen und begründeten Einspruchs
491
Nach der Definition von Art. 4 Nr. 24 DSGVO kann ein Einspruch in zweiKonstellationen maßgeblich sein: Zum einen kann die betroffene Aufsichtsbehörde vortragen, dass die federführende Aufsichtsbehörde zu Unrecht von einem Verstoß gegen die DSGVO seitens des jeweiligen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters ausgeht oder einen tatsächlich vorliegenden Verstoß fälschlicherweise verneint. Zum anderen kann sich ein maßgeblicher und begründeter Einspruch dagegen richten, dass eine seitens der federführenden Aufsichtsbehörde beabsichtigte Maßnahme gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter nicht im Einklang mit der DSGVO steht; dies kann etwa der Fall sein, wenn die federführende Aufsichtsbehörde trotz eines festgestellten Verstoßes gegen die DSGVO nicht beabsichtigt, gegen den jeweiligen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter einzuschreiten oder jedenfalls nach Ansicht einer betroffenen Aufsichtsbehörde eine zu milde oder aber auch zu strenge Maßnahme ergreifen will.
492
Der Einspruch ist begründet, wenn er die Tragweiteder Risiken des Beschlussentwurfs klar erkennen lässt, die für die Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen und gegebenenfalls für den freien Verkehr personenbezogener Daten bestehen.
493
Darüber hinaus schweigt die DSGVO zu den weiteren erforderlichen Inhalten eines solchen Einspruchs oder dessen erforderlichen Maßes an Konkretisierung. Ausweislich ErwG 124 Satz 4 obliegt es dem Europäischen Datenschutzausschuss, durch Leitlinienweiter herauszuarbeiten, welche Anforderungen an einen maßgeblichen und begründeten Einspruch zu stellen sind.
494
Ob die vorgebrachten Gründe auch materiellrechtlich zutreffend sind, ist für die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen der Begriffsbestimmung unerheblich.859 Die inhaltliche Entscheidung darüber, ob der Einspruch letztlich durchgreift oder nicht, obliegt vielmehr dem Europäischen Datenschutzausschuss im Rahmen des Streitbeilegungsverfahrens nach Art. 65 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Vorlage eines maßgeblichen und begründeten Einspruchs stellt dabei lediglich eine Verfahrensvoraussetzung dar.
XXVI. Dienst der Informationsgesellschaft (Nr. 25)
1. Rechtlicher Hintergrund/Gesetzessystematischer Zusammenhang
495
Im Rahmen der DSGVO findet der Begriff des Dienstes der Informationsgesellschaft prominenteste Erwähnung im Rahmen von Art. 8 DSGVO, der besondereVoraussetzungen an die Einwilligungserteilung von Minderjährigen im Rahmen ebensolcher Dienste zum Gegenstand hat. Darüber hinaus nehmen die Regelungen von Art. 17 Abs. 1 lit. f (Recht auf Löschung), Art. 21 Abs. 5 (Widerspruchsrecht) sowie Art. 97 Abs. 5 DSGVO Bezug auf die Begriffsbestimmung.
2. Merkmale des Dienstes der Informationsgesellschaft
496
Art. 4 Nr. 25 DSGVO definiert den Begriff des Dienstes der Informationsgesellschaft nicht eigenständig, sondern enthält einen Verweis auf die entsprechende Definitiondes Art. 1 Nr. 1 lit. b der RL 2015/1535/EU.860 Hiernach wird eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft als jede in der Regel gegen Entgelt, elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung definiert.
497
Die Begriffsbestimmung sieht demnach fünf Voraussetzungen vor, die kumulativ vorliegen müssen. Die Regelung des Art. 1 Nr. 1 lit. b der RL 2015/1535/EU konkretisiert dabei drei dieser Voraussetzungen und enthält in Anhang I diesbezüglich jeweils eine Negativliste. Hinsichtlich des Dienstleistungsbegriffs sowie des Merkmals „in der Regel gegen Entgelt“ ist auf die zu den Art. 56ff. AEUV entwickelten Grundsätze zurückzugreifen:
498
Bei dem Begriff der „Dienstleistung“ ist der allgemeine und weite Begriff der Dienstleistungsfreiheit der Art. 56ff. AEUV zugrunde zu legen. Danach sind alle selbstständigen Leistungen erfasst, die nicht den anderen Grundfreiheiten des AEUV unterfallen. Insbesondere sind – in Abgrenzung zur Warenfreiheit (Art. 34 AEUV) – ausschließlich nichtkörperliche Leistungenumfasst.861 Hierbei ist auf den Schwerpunkt der jeweiligen Leistung abzustellen.862 Demnach fällt etwa ein Webshop zur Bestellung körperlicher Waren unter die Warenverkehrsfreiheit und ist demnach (isoliert) nicht als Dienstleistung i.S.v. Art. 57 AEUV bzw. Art. 1 Nr. 1 lit. b der RL 2015/1535/EU zu klassifizieren.863 Gleiches gilt für die Bewerbung körperlicher Waren.864 Etwas anderes ergibt sich jedoch unter Umständen dann, wenn dem jeweiligen Angebot ein eigener Leistungscharakter zukommt.865 Weitere Eingrenzung erhält der weit zu verstehende Begriff der Dienstleistung durch die übrigen in Art. 1 Nr. 1 lit. b der RL 2015/1535/EU genannten Tatbestandsmerkmale.866
b) In der Regel gegen Entgelt erbracht
499
Auch das Merkmal „in der Regel gegen Entgelt“ dürfte im Zusammenhang mit dem Begriff der „Dienstleistung“ im Lichte der vom EuGH entwickelten Grundsätze zu den Art. 56ff. AEUV auszulegen sein.867 Nach der Rechtsprechung des EuGH bedarf es somit grundsätzlicheiner wirtschaftlichen Gegenleistung,868 wobei diese Gegenleistung nicht zwangsläufig auch durch die tatsächlichen Nutzer erbracht werden muss.869 Eine solche Gegenleistung ist bereits anzunehmen, wenn sich der betreffende Dienst beispielsweise durch Werbeeinnahmen870 oder durch die Generierung bzw. den Handel mit Nutzerdaten finanziert.871 Das Merkmal setzt demnach nicht voraus, dass der Nutzer im konkreten Fall eine monetäre Gegenleistung erbringt, mithin dass Leistung und Gegenleistung in einem direkten, synallagmatischen Austauschverhältnis stehen.872 Entscheidend ist vielmehr, dass der Dienst selbst auf kommerzieller Basis erbracht wird, etwa da er zur (indirekten) Bewerbung von Waren oder anderen Dienstleistungen angeboten wird.873 Ferner bejaht der EuGH eine Entgeltlichkeit auch dann, wenn nicht der Leistungsempfänger, sondern ein Dritter die Gegenleistung erbringt.874 Eine Entgeltlichkeit kann auch im Falle von öffentlichen Leistungen anzunehmen sein, sofern diese nicht im Wesentlichen aus dem allgemeinen Staatshaushalt, mithin durch Steuern, und nicht durch eine entsprechende Gegenleistung, also etwa durch Beiträge oder Gebühren, finanziert werden.875
c) Im Fernabsatz erbracht
500
Eine „im Fernabsatz erbrachte“ Dienstleistung ist eine Dienstleistung, die ohnegleichzeitige physische Anwesenheit der Vertragsparteien erbracht wird. Es genügt nicht, wenn die jeweilige Dienstleistung mittels elektronischer Geräte erbracht wird, die Vertragsparteien hierbei jedoch anwesend sind.
501
Eine Dienstleistung ist „ elektronisch erbracht“, wenn sie mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und dabei vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderem elektromagnetischen Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird.
Читать дальше