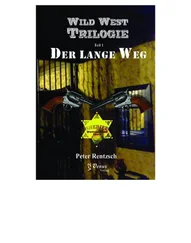Ich entschied mich zum Laufen, mit gezieltem Rennrad-Training zu beginnen und ins Fitnessstudio zu gehen. Alles für meinen Wunsch, irgendwann an einem Duathlon-Wettkampf teilzunehmen. Und ich hatte damit wenigstens ein sportliches Ziel vor Augen, das meine Psyche und vor allem mein Durchhaltevermögen stärkte. Dass es zu einer absoluten Flucht am Limit werden würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen.
Allerdings musste ich erneut gegen die weitläufige Meinung meiner Umwelt ankämpfen, dass dieser Sport mich nur noch weiter kaputt machen würde.
Ich dagegen konnte in meinen Gedanken MICH nicht weiter zerstören, lediglich meinen Körper quälen, um psychisch zu überleben!
Am meisten litten meine Eltern an meiner mittlerweile chronischen Erkrankung. Sie hatten alles versucht, um meine Anorexie zu „heilen“. Aber sie merkten auch, dass ich mich vor ihnen weitgehend verschloss, ihnen ständig auswich oder aber eine Besserung versprach. Sie konnten mir nicht weiterhelfen, weil ich es selbst verhinderte. Und letztendlich waren sie auch gegen weitere Therapieversuche, weil sie mit ansehen mussten, dass ich dadurch noch kränker wurde und noch mehr Gewicht verlor.
Aus meiner heutigen Sicht möchte ich an dieser Stelle sehr betonen, dass meine Eltern absolut keine Schuld hatten, weder am Ausbruch meiner Anorexie noch an ihrem chronischen Krankheitsverlauf. Eine Sucht ist von außen kaum zu beeinflussen, wenn der Süchtige nicht selbst den Entschluss fassen kann, aus seiner Krankheit auszusteigen, absolut alle Kräfte dafür zu mobilisieren, die Sucht zu besiegen. Und ich selbst konnte damals noch nicht ausbrechen, weil der eigentliche Grund meiner Anorexie noch ganz tief als vernichtender Stachel in mir steckte. Ich war noch längst nicht so weit und bereit, mich meinen Eltern gegenüber zu öffnen. Aus zweierlei Gründen:
Das Verhältnis zu meiner Mutter wurde schon zu Beginn meines Studiums im Jahr 1997 immer herzlicher und intensiver. Ich fühlte mich von ihr in meinem Leid verstanden, weil sie alles versuchte, hinter meine harte Hülle in mein Herz zu blicken. Obwohl sie mit dem Verstand meine Krankheit nicht nachvollziehen konnte, waren ihr Mitgefühl und ihre Fürsorge die größte Stütze für mich, immer wieder aufzustehen und einen nächsten Schritt für eine Besserung zu wagen. Denn ich spürte, ich war nicht allein, und sie glaubte an mich und eine bessere Zukunft. Sie wusste damals genauso wenig wie ich den Weg zum Ziel. Aber sie sah ein Ziel, das Ziel der Gesundheit, das für mich noch lange im Dunkel lag. Und ging es zwischendurch bergauf, dann deshalb, weil ich mich für sie und zum Dank für ihre Liebe bemühte. Auch wenn es für mich selbst nicht weit nach oben gehen durfte, war sie der Grund, warum ich nicht aufgeben konnte und weiterkämpfte. Allerdings mit meiner Sucht und noch lange nicht gegen sie!
Doch dieses herzliche, tiefe Verhältnis zu meiner Mutter war auch der Grund, warum ich ihr nicht die Wahrheit sagen und mich ihr mit meinen tiefen Identitätsproblemen nicht öffnen konnte. Ich hatte zu große Angst, sie zu verletzen und ihr wehzutun, weil sie sich so sehnlichst ein Mädchen wünschte. Doch ihre großartige Hilfe, das unbeschreibliche Leid, das sie mit mir durchgemacht hat und ertragen musste, ohne daran selbst zu zerbrechen, sollte in ferner Zukunft noch belohnt werden!
Das Verhältnis zu meinem Vater dagegen wurde mit meiner Anorexie sehr viel schwieriger. Er konnte meine Erkrankung noch viel weniger verstehen als meine Mutter. Vor allem fühlte ich mich von ihm nicht verstanden. Seine Fürsorge bestand hauptsächlich darin, mich mit materiellen Dingen überaus gut zu versorgen. Doch das war mir damals viel weniger wichtig. Was ich mir von ihm sehnlichst wünschte, konnte er mir kaum geben. Es fiel ihm sehr schwer, Gefühle zu zeigen, und er konnte sie vor allem nicht in Worte fassen! Teilweise fühlte ich mich ihm gegenüber schuldig, wenn er wieder einmal absolut nicht mit meiner Erkrankung zurechtkam und mir mein „Handeln“ vorhielt. Seine Sorge war vielfach seine Härte, die ich spürte und die mir wehtat. Zwischen uns prallten Gefühlswelten aufeinander, die zu Missverständnissen und einem sehr angespannten, schwierigen Verhältnis führten. Ging es mir allerdings an manchen Tagen sehr schlecht, dann wurde er weich, und er konnte seine Fürsorge zeigen, mit Gefühl, wie ich es mir viel öfter gewünscht hätte. Doch durch seine Art, die er genauso wenig ablegen konnte wie ich meine Magersucht, hätte ich mit ihm niemals über meine Probleme reden können.
Aber meine Eltern haben alles gegeben, was sie in ihrem großen Leid und ihrer Verzweiflung, mich vielleicht doch zu verlieren, geben konnten. Viele Tränen und Kräfte steckten in der jahrzehntelangen Begleitung ihres Kindes. Auch wenn es weiter schwieg und ein Ende seiner furchtbaren Erkrankung nicht zu erkennen war.
Aber ohne sie und ihre unbeschreibliche Unterstützung wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt sein darf.
Doch die allergrößte Herausforderung stand erst noch vor ihnen und vor mir.
Ein Kampf meiner „Extreme“, die mich in eine weitere unumgängliche Abhängigkeit von meinen Eltern führte, anstatt mich von ihnen langsam, aber sicher zu lösen.
Meine Jugend hatte ich mir selbst geraubt, und erwachsen konnte ich nicht werden …
Im Jahr 2000 folgte ein Ereignis, das mich mit einem Schlag für weitere 16 Jahre in die Finsternis katapultierte, in deren Dunkelheit sich die meisten Zeitabschnitte für immer aus meinem Gedächtnis verloren.
Meine „ausgelöschten“ Jahre – Die Zeit zwischen 2000 und 2015
In meiner stabilsten „Phase“ wurde ich im Jahr 2000 vergewaltigt.
Nüchterne, trockene Worte für ein Ereignis, dessen Folgen ich bis heute nur schwer in Worte fassen kann. An dieser Stelle soll das Geschehen von mir auch nicht weiter beschrieben werden. Es wird im Kapitel „2016 – Das Jahr der Kontaktaufnahme“ von mir zweimal intensiv aufgegriffen, weil ich es solange tief in den Trümmern meiner Seele geheim hielt. Ich möchte daher bewusst in diesem Kapitel darüber „schweigen“ und auf meine Briefe weiter hinten verweisen.
Die Folgen für mich waren immens. Ich war zutiefst geschockt, gelähmt und körperlich sowie psychisch schwer gezeichnet. Meine Gefühle waren wie zementiert, und alles in mir schien zerstört, zerfetzt in tausend Stücke. Ich war keine Person mehr, sondern ein „Nichts“. Die letzte leise Stimme meines „gefangenen Ichs“ wurde vollends erdrückt und verhallte in mir. Meine Gedanken verliefen sich in dunklem Nebel, der mich immer weiter in die Tiefe zu drücken schien. Alles unterhalb meiner Gürtellinie war wie taub, und ich befand mich in einem gefühlten „Vakuum“, das mich immer weiter zusammenzog. Meine Umwelt verschwand hinter dem grausamen Film vor meinen Augen, der keinen realen Blick mehr erlaubte. Und ich hatte riesige Angst. Eine Panik, die mich nicht nur zu absolutem Schweigen zwang, sondern mich in die Flucht trieb. Ein Lauf von mir weg ohne Ziel, angetrieben von unbeschreiblichem Selbsthass und einer neu entfachten Selbstzerstörungswut.
Meine einzige Beruhigung fand ich in einem starken Schmerzmittel, einem Betäubungsmittel „Valoron“, das mir der Frauenarzt in der Not verschrieb, weil er mich nicht einmal richtig untersuchen konnte.

Bericht 1 – Mitteilungsblatt vom 16.11.2000
Fortan rannte ich von mir weg, und das Mittel dazu war mein Sport. Das Training wurde zu einem mörderischen Plan gegen meinen Körper. Doch nicht um mich dabei umzubringen, sondern erneut um mir von außen Anerkennung zu erkämpfen.
Aus meiner heutigen Sicht rettete mir der Ausdauersport zu diesem Zeitpunkt mein Leben. So provokativ diese Aussage auch klingen mag. Aber ohne meine sportlichen Wettkämpfe hätte ich mir wahrscheinlich sogar aus Verzweiflung das Leben genommen.
Читать дальше