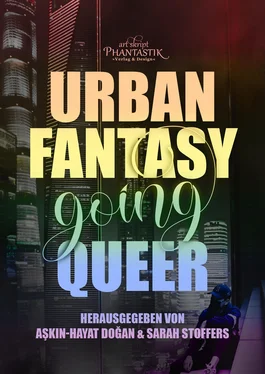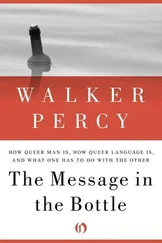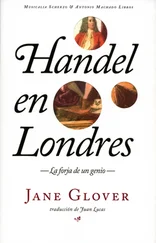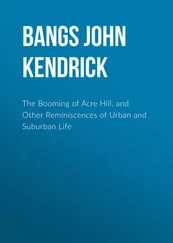Ehe ihr fragt: Nein, ich kann meine Fähigkeiten nicht an mir selbst anwenden. Das wäre ja auch albern. Ich bin Muse, keine Künstlerin. Ich schaffe nicht, ich kreiere nicht. Ich bringe andere dazu, etwas zu erschaffen und die Begabung zu entfalten, die in ihnen schlummert. Zumindest ist das der Plan. Die Wahrheit ist aber: Ich bin die beschissenste Muse aller Zeiten.
Es ist nicht so, als hätte ich im Laufe meiner Karriere nie irgendetwas zustande gebracht. Ich schätze, Mary Shelley ist euch ein Begriff, ja? Gut. Keith Haring? Oh, kommt schon, Achtzigerjahre Pop-Art? Diese bunten, eckigen Comic-Männchen? Geez. Dann vielleicht Israel Kamakawiwo’ole, diese Wahnsinnsstimme von Somewhere Over the Rainbow?
Okay, ich will nicht lügen, so geht es mir immer, wenn ich meine wenigen Erfolgsgeschichten erzähle, und es fuckt mich ab. Ehrlich. Ja, dann war ich vielleicht nicht die treibende Kraft hinter einem Mozart, einem Monet oder einem Johann Wolfgang von fucking Goethe, aber verdammt, meine Leute hatten Talent! Unfassbares Talent! Sie hatten nur das »Scheißpech«, eine Frau, schwul oder ein Native zu sein. Und, na ja, früh zu sterben.
Könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist? Es gibt so viele unfassbar talentierte Leute da draußen und diese Menschen zu unterstützen und ihr Potenzial zu entfalten, fühlt sich erfüllend und großartig an. Und am Ende brandest du irgendwo gegen eine gläserne Decke. Die Verantwortlichen schwafeln irgendwas davon, dass nur Talent zählt, dass es ja gar nicht auf Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer ankäme. Scheiße, verdammt, ich sehe Talent! Ich fühle es! Und ich weiß genau, wie viele talentierte Menschen nie den Glanz und den Ruhm bekommen haben, die sie verdienten, einfach, weil sie nicht dem Wunschbild der Mehrheitsgesellschaft entsprachen oder von ihr im Stich gelassen wurden.
Tja, meine Kolleg*innen waren schlauer als ich. Die haben sich die Talente herausgepickt, die erfolgversprechend waren. Die nicht am Hungertuch nagten und irgendwann die Entscheidung treffen mussten, ob sie Künstler*innen sein oder ein menschenwürdiges Leben führen wollen. Oder wenigstens solche, die nach ihrem Tod sprunghaft an Bekanntheit gewannen, weil die Welt einen gewissen Typus des »leidenden Künstlers« doch ganz charmant findet.
»Wir mischen uns nicht ein«, sagen sie immer. »Wir Musen inspirieren, wir entscheiden nicht.«
Die Erregung flirrt in meinen Fingerspitzen, ich kann kaum die Kaffeetasse halten. Sie sind so feige, allesamt. Klammern sich an ihren Status quo wie ein Alki an seine Flasche Schnaps.
Ja, toller Vergleich, Mel. Warum bist du noch gleich hier? Ach ja, weil du dich mit achtzigprozentigem Korn beinahe ins Koma gesoffen hättest. Super Nummer für eine Muse. Ehrlich. Aber scheiße, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht so tun, als wäre mir das egal. Ich will mich nicht anpassen, ich will nicht zusehen, wie dieses Potenzial einfach verschwindet, weil sich die Welt entschieden hat, lieber eine kapitalistische Konsumhölle zu sein als ein kreatives Paradies. Ich bin es leid, mitzuerleben, wie Künstler*innen ihre Träume aufgeben, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ich kann so nicht arbeiten, verdammte Scheiße!
Hilflosigkeit und Frust schnüren mir die Kehle zu und im selben Moment spüre ich eine Berührung am Arm.
»He, alles okay?«
Ich blinzle und blicke meine Mitpatientin an, die sich gerade mit einer Schale Müsli und einem Tee neben mich gesetzt hat. Sie ist Schwarz – vielleicht auch Mixed – und trägt Cornrows, die in zwei feste, geflochtene Zöpfe übergehen. Auf ihrem ausgeblichenen T-Shirt steht No fucks given. Sie ist mir jetzt schon sympathisch, aber das spielt im Grunde keine Rolle, denn allein ihre Anwesenheit lässt meinen Puls flirren. Da ist dieses Prickeln hinter meinen Schläfen und ich gebe mir Mühe, sie nicht anzustarren, obwohl die Kraft und die Intensität, die von ihr ausgehen, überwältigend sind. Es ist wie ein Klingeln in meinen Ohren, ein warmes, wunderschönes Gefühl, das meinen Brustkorb füllt und jede Faser meines Körpers durchdringt. Liebe kann sich nicht besser anfühlen.
»Ähm ja«, nuschle ich hastig, um nicht aufzufallen. »Geht schon. Bin nur ziemlich groggy.«
Die Aura, die sie umfängt, dringt in jede meiner Poren, als ich sie ansehe, und fast muss ich lachen. Hier. Ausgerechnet hier. Aber warum nicht? Künstlerisches Talent ist nichts, das man nur auf Universitäten, Kunsthochschulen oder Oscar-Verleihungen findet. Wenn man sich ansieht, wie viele kreative Genies im Laufe ihres Lebens Stress mit Alkohol oder Drogen hatten, dürfte die Trefferquote in Entzugskliniken gar nicht so niedrig sein. Aber hier, in diesem Kaff, irgendwo in der hessischen Provinz? Wie wahrscheinlich ist das?
Meine Sitznachbarin nippt an ihrem Tee und lächelt mitfühlend. »Ja, ging mir am Anfang auch so. Bist du schon lang hier?«
»Nein, ne Woche etwa. Ich bin Mel, übrigens.«
»Sharon. Freut mich.«
Mir liegt die Frage auf der Zunge, warum sie hier ist, aber ich schlucke sie wieder hinunter. Das geht mich nichts an. Also, es geht Mel, die Patientin, nichts an. Die Muse Melete vielleicht schon.
Ich verwickle Sharon in ein wenig Smalltalk. Essen, Zimmer, Wetter. Worüber man eben redet, wenn man den Elefanten im Raum nicht ansprechen will. Am Ende tut sie es aber doch.
»Warum bist du hier?«
»Alkohol«, brumme ich halblaut. »Und du?«
»Benzodiazepine«, antwortet sie. »Xanax und so, Beruhigungstabletten, du weißt schon.«
Ich nicke. Elvis war auch süchtig nach dem Zeug, Michael Jackson ist sogar daran gestorben. Da war ich aber nicht beteiligt. Das schwöre ich. »Dein erster Entzug?«
Ihre Antwort klingt ungewöhnlich heiter: »Hatte die Schnauze voll. Anfangs dachte ich, die Entzugserscheinungen wären immerhin besser als die Flashbacks, aber nope. Sind sie nicht.«
Wieder nicke ich nur. Ich weiß genau, was sie meint. Selbstmedikation. Den einen Kummer durch ein anderes Ärgernis eintauschen. Geht selten gut aus. Ich würde Sharon gerne fragen, welche Flashbacks sie quälen. Ob sie eine Überlebende ist. Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Ich hasse das Klischee vom »leidenden Künstler«, diese romantisierte Vorstellung, kreative Menschen müssten Leid und Entbehrung ertragen, damit sie etwas Bedeutendes schaffen können. Bullshit! Als würden Existenzängste, psychische Belastungen und Minoritätenstress nicht jeden kreativen Impuls lähmen. Vor allem dann, wenn die Täter*innen selbst ganz oben in diesem Business stehen. Und dennoch, ich glaube daran, dass neurodiverse Menschen einen besonderen Zugang zu Kreativität haben. Einen, den die Welt oft nicht sieht, weil sie in ihren normativen Bahnen denkt. Aber ich sehe ihn.
»Außerdem«, fährt sie fort, »macht mich das Zeug komplett wuschig im Hirn. Früher hab ich immer Songs geschrieben, um runterzukommen, aber auf Xanax hab ich keine einzige Zeile zustande gebracht.«
Ich merke, wie meine Finger vor Anspannung kribbeln, und nehme zur Ablenkung einen weiteren Schluck Kaffee. Die Tasse zittert so sehr in meinen Händen, dass ich einen Teil davon verschütte. »Du bist … Musikerin?«
»Mehr oder weniger. Bin aus meiner alten Band ausgestiegen und wollte solo weitermachen, aber dann ging es mit den Benzos los und ich bekam nichts mehr auf die Kette.« Sie lacht, es klingt eine Spur zynisch. »Ich bin also eine ziemlich unnütze Musikerin.«
Читать дальше