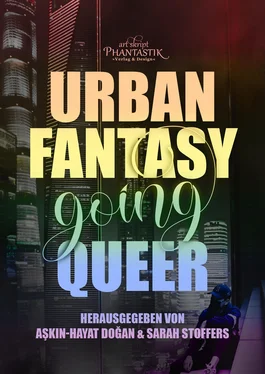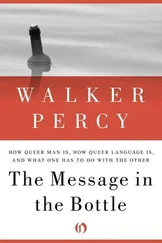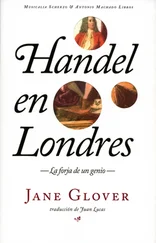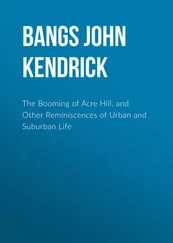»Wir treffen uns draußen, okay? Ich will mich noch von jemandem verabschieden.«
Grace wirft ihm einen fragenden Blick zu, gibt aber ausnahmsweise keinen Kommentar ab. Stattdessen geht sie in Richtung Garderobe und er kehrt zu seinem Stammplatz, der Couch, zurück. Zu seiner Enttäuschung ist Evie verschwunden. An ihrer Stelle findet er nur ein pinkes, herzförmiges Post-It mit einer Telefonnummer vor. Jake faltet es vorsichtig und steckt es in seine Hosentasche. Mit einem Mal ist er doch froh, heute Abend auf die Party gekommen zu sein. Auch, wenn er gerade festgestellt hat, dass er offenbar Gefühle für seine beste Freundin hat. Gefühle, von denen er weiß, dass sie nicht erwidert werden und die er auch gar nicht haben will. Aber so ist nun mal sein Leben. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert und vermutlich auch nicht das letzte. Er wird jetzt nach Hause gehen und sich ordentlich ausschlafen. Und morgen früh wird er eine Liste machen, mit all den Dingen, die er an Grace nicht mag und allen Gründen, warum eine Beziehung zwischen ihnen nicht nur unmöglich, sondern auch eine absolut furchtbare Idee wäre. Und wenn das nicht gegen seine Verknalltheit hilft, dann wird er eben abwarten. Jake ist sich sicher, dass seine Gefühle in ein paar Tagen so plötzlich verfliegen werden, wie sie gekommen sind. Und wer weiß, vielleicht wird er dann Evie anrufen und sie können sich gemeinsam über die Menschen aufregen, mit denen sie zusammenwohnen.
-----------------------------------------------------------
Jenny Cazzola, zweisprachig, Waisenkind und bisexuell, das ist Jenny Cazzola, Jahrgang 1996. Sie sitzt im Rollstuhl, arbeitet im Marketing und träumt von einer Welt, in der alle gleich viel wert sind. Das Mittel ihrer Wahl um dieses Ziel zu erreichen, ist das Schreiben. Sie ist der Meinung, dass das Leben selber die schönsten und die schrecklichsten Geschichten schreibt, deshalb schreibt sie am liebsten Young und New Adult und über ihr eigenes Leben. Wenn die gebürtige – und immer noch dort lebende – Südtirolerin ihre Nase nicht gerade in Bücher steckt, oder lauthals deutsche Punksongs grölt, surft sie im Internet. Jenny ist die selbsternannte Queen of Kurzgeschichten und hat schon mehrere ihrer Geschichten in Anthologien veröffentlicht. Besonders stolz ist sie auf ihre Beteiligung an »Urban Fantasy: Going Intersectional« von Aşkın-Hayat Doğan & Patricia Eckermann.
Content Notes: Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, Entzug, Depression, Diskriminierung, Psychiatrie, Erwähnung von Trauma und sexueller Gewalt
Elea Brandt
Ich habe geschlafen. Ja, das klingt banal, aber es ist eine Sensationsmeldung. Seit Beginn des Entzugs habe ich kaum ein Auge zugetan. Jede Nacht war die Hölle. Der kalte Schweiß klebte an den Bettlaken, bescherte mir Schüttelfrost, bis meine Zähne aufeinanderschlugen. Die meiste Zeit war mir kotzübel, ich brachte nichts runter, höchstens die eine mickrige Tasse Kaffee am Morgen – und selbst der schmeckte scheiße. Die Medis helfen ein bisschen, mein Hirn fühlt sich jetzt an, als wäre es in Watte gepackt. Meine Gedanken sind träge und schwerfällig, aber sie kreisen nicht mehr ständig um Selbsthass und Weltschmerz. Könnte schlechter sein.
Ich rapple mich auf und dehne meinen schmerzenden Nacken. Mir tut echt alles weh, diese Klinikbetten sind hart wie Stahl. Das vergitterte Fenster erweckt den Eindruck eines Gefängnisses, auch wenn ich draußen direkt in einen Garten blicke, der die Klinik umringt. Das Grün tut gut. Die letzten Wochen habe ich nur auf Beton gestarrt, auf die rissigen Wände in meiner schmutzigen Bude im Frankfurter Bahnhofsviertel und auf die schmierigen Tresen billiger Kneipen. Das hier ist besser, definitiv.
Ich öffne das Fenster und lasse etwas kalte Luft hereinströmen. Ich bin froh, in einem Einzelzimmer zu liegen, gerade ist mir nicht nach Gesprächen. Ich weiß, dass sich das ändern muss, deswegen bin ich ja hier, doch zuerst brauche ich einen guten Plan. Es heißt immer, in der Therapie wäre Offenheit wichtig, aber wie soll ich das anstellen?
»Hi, ich bin Melete, meine Pronomen sind sie/ihr und ich bin eine Muse.«
Eine depressive, alkoholabhängige Muse, um genau zu sein. Soweit noch okay, aber dann kämen die Fragen und die unausweichliche Tirade von misogynen Vorurteilen. Erfolgreiche Männer und ihre Musen, ihr wisst schon. Zwinki-zwonki. Zur Klarstellung: Ich bin ein Profi und ich schlafe nicht mit meinen Klient*innen. Sex ist eh nicht so mein Ding und Männer auch nicht. Ich bin eine Stone Butch Muse. Aber egal, das ist eine andere Geschichte.
Ab da wird es jedenfalls kompliziert. Meistens erkläre ich den Leuten, ich sei eine Art Lifecoach. Das klingt modern und hip. Dass ich in der Lage bin, kreative Schwingungen zu spüren und zu verstärken, dass ich Menschen mit einem Fingerschnippen in einen Flow versetzen und zumindest für eine Weile die Zweifel aus ihren Gedanken vertreiben kann, behalte ich doch lieber für mich. Für die meisten klingt das entweder nach Zauberei oder nach Scharlatanerie.
Eigentlich ist es nichts von beidem, es ist vielmehr eine Mischung aus Begabung und Handwerk. Ich spüre die Emotionen und Schwingungen anderer Menschen. Ich kann sie fühlen, auf der Zunge schmecken und sogar riechen. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie Hass riecht oder Angst. Ziemlich eklig, das kann ich euch sagen, aber es gibt nichts, womit ich das beschreiben könnte. Menschen mit besonderen Talenten und Begabungen ragen für mich aus der Menge heraus wie ein explodierendes Leuchtfeuer. Ich finde sie immer, irgendwie. Menschen, die Worte wie Geschosse nutzen, die außergewöhnliche Gemälde schaffen oder Melodien schreiben, die einem das Herz zerreißen.
Was danach kommt, ist im Grunde nur Neurologie und ein Hauch von Metaphysik. Ich vertiefe mich in mein Gegenüber und steuere bestimmte Frequenzen an, um die neuronale Aktivität zu beeinflussen. Das Cortisol steigt an, der präfrontale Kortex, der für rationales, strategisches Planen zuständig ist, fährt herunter und ich flute die Amygdala mit Lust und Dopamin. Aber ich will euch nicht mit physiologischem Blabla langweilen. Die Kurzfassung ist: Ich bringe Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten. In der Theorie zumindest, denn in der Praxis – nun, ihr seht es ja. In der Praxis sitze ich im sterilen Zimmer eines psychiatrischen Bezirkskrankenhauses, kämpfe gegen das Verlangen nach einem Schluck Wodka und schleppe mich ins angrenzende Badezimmer für eine Dusche.
Ich drehe das heiße Wasser voll auf und lasse es auf meine Haut prasseln bis knapp an die Schmerzgrenze. Mein schwarzes Haar ist so raspelkurz, dass es binnen Sekunden trocknet. Das ist ganz praktisch. Ich reibe es mit Shampoo ein, stelle mich erneut unter den heißen Wasserstrahl und sehe zu, wie die Seife in einer milchig-weißen Bahn im Abfluss verschwindet. Das winzige Bad ist voll schwerer Dampfschwaden, als ich wieder aus der Dusche steige, der Spiegel komplett beschlagen. Besser so. Ich muss meine Augenringe nicht sehen, um zu wissen, dass sie da sind.
Gerade bin ich in T-Shirt und Jogginghose geschlüpft, da klopft es an der Tür und eine freundlich lächelnde Pflegekraft ruft mich zum Frühstück. Ich habe keinerlei Appetit, aber irgendwas werde ich schon runterwürgen, und wenn es nur eine Tasse tiefschwarzer Kaffee ist. Wenigstens sehen die anderen Patient*innen ringsum genauso fertig aus, wie ich mich fühle. Das beruhigt mich irgendwie. Andererseits sind die halt auch Menschen, keine übersinnlichen Wesen mit abgefahrenen Gimmicks wie ich.
Читать дальше