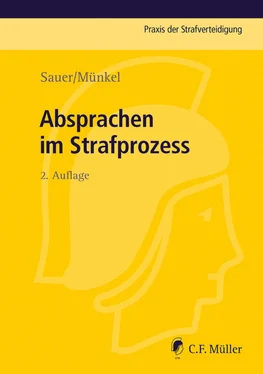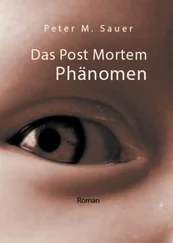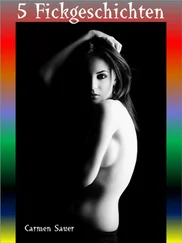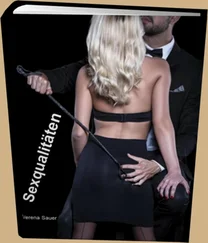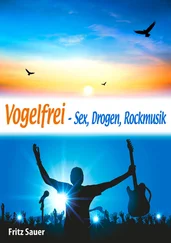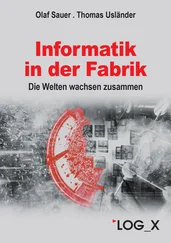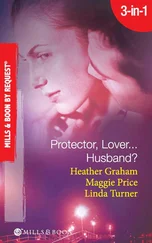[7]
Und bzw. oder sich auch um das materielle Strafrecht allenfalls sehr bedingt scheren.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Vorwort der Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1 Grundlagen: Für den Konsens, gegen den „Deal“
A. Ausgangspunkt: Urteilsabsprachen nicht als Umwälzung, sondern als Ergänzung der StPO
B. Möglichkeiten konsensualer Verfahrenserledigungen im deutschen Strafprozessrecht
I.Das Strafbefehlsverfahren und §§ 153 ff. als hergebrachte Möglichkeiten konsensualer Verfahrenserledigungen
1. Hintergründe und Problematik der Vorschriften
2. Faktische Existenz konsensualer Verfahrensbeendigungen als zwingende Folge
II.Das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren im Überblick
1. Entstehungsgeschichte
2. Die „großen Linien“ der Reform
C. Einordnung der Entwicklung
I.Positionsbestimmung
1. Rechtspolitik, Rechtsdogmatik, Rechtsanwendung
2.Gegenkritik
a) Vermischung von Rechtspolitik und Rechtsdogmatik
b)Rechtsdogmatik contra legem
aa) Rechtsdogmatik de lege lata!
bb) Keine höheren Anforderungen als an nicht abgesprochene Urteile
cc) Widerspruch zur Anerkennung des Strafbefehlsverfahrens
dd) Begrenzt sinnvolle Suche nach einer „Rechtsnatur“
3. Terminologie und Gang der Darstellung
II.Mutmaßliche Ursachen der Stärkung konsensualer Elemente im Strafprozess
1. Von der Vergeltung zur Prävention
2. Das „Opfer“ als Prozesssubjekt
3. Problematische Ausweitungen von Strafbarkeitsbereichen
4. Vom Strafprozess zum Meta-Verfahren
5. Zwischenfazit
III.Erste praktische Konsequenzen der Bindung an das geltende Recht
1. Kein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Prozessrecht und Mandanteninteresse
2. Weder Wunderwaffe noch Bankrotterklärung der Verteidigung
3. Kein durchgängiger Widerspruch zwischen Konflikt und Konsens
Teil 2 Verfahrensbeendigende Verständigungen jenseits der Urteilsabsprache
A. Vorbemerkungen zur Stärkung des dialogischen Elements in der StPO: §§ 160b, 202a, 212, 257b
I. Übersicht
II.Einzelheiten
1. Verfahrensbeteiligte
2. „Aktenkundig zu machen“
3. Voraussetzungen und Folgen
B. Die Ausgestaltung des Opportunitätsprinzips in der StPO im Einzelnen: §§ 153 ff.
I. Übersicht
II.Einstellung wegen Geringfügigkeit oder nach Erfüllung von Auflagen, §§ 153, 153a
1.Voraussetzungen und Mitwirkungsmöglichkeiten
a) Anwendungsbereich
b) Schuldschwere und öffentliches Interesse an der Strafverfolgung
c) Zustimmungserfordernisse
2.Hinweise zum Verfahren bei § 153a
a) Vorläufige Einstellung, Auflage und Auflagenerfüllung
b) Endgültige Einstellung
c) § 153a und Geständnis
III. Absehen von Verfolgung und Beschränkung der Strafverfolgung nach §§ 154, 154a
IV. Exkurs: Entschädigung für erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen nach den Bestimmungen des StrEG bei Einstellung des Verfahrens nach § 153 ff
V. Fristsetzung nach § 154d
C. Diversion im Jugendstrafrecht
I. Überblick
II. Unterschiede zwischen §§ 153, 153a und §§ 45, 47 JGG
III.Zu den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten nach §§ 45, 47 JGG
1. Übersicht
2. Einstellung wegen Geringfügigkeit, §§ 45 Abs. 1; 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 JGG
3. Einstellung mit Blick auf erzieherische Maßnahmen §§ 45 Abs. 2; 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 JGG
4. Formloses jugendrichterliches Erziehungsverfahren §§ 45 Abs. 3, 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 JGG
5. Zur Rechtswirkung der Einstellung nach §§ 45, 47 JGG
IV. Konkurrenz der §§ 45, 47 JGG zu §§ 153, 153a
D. Einstellungsmöglichkeiten im Betäubungsmittelstrafrecht
I. Überblick
II. § 31a Abs. 2 BtMG
III. § 37 BtMG
E. Das Strafbefehlsverfahren, §§ 407 ff
I. Vorbemerkungen zu Strafbefehl und Verständigung im Strafprozess
II. Einzelfragen des Strafbefehlsverfahrens
F. Konsensuale Elemente im Recht der Ordnungswidrigkeiten
I. Überblick
II. Entscheidung über die Einspruchserhebung
III. Einstellung aus Opportunitätsgründen
1. Voraussetzungen der Einstellung nach § 47 OWiG
2. Folgen der Einstellung nach § 47 OWiG
3. Wechselwirkungen zwischen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
G. Konsensuale Elemente im Bereich des Privatklageverfahrens
Teil 3 Die Urteilsabsprache nach der Reform der StPO
A. Vorbemerkungen
B. Rückblick: Die Urteilsabsprachen in der früheren Rechtsprechung des BGH
I. Ausgangsüberlegungen
II. Formale Vorgaben
III. Inhaltliche Vorgaben
IV. Fehlerfolgen, insbesondere Revisibilität von Regelverstößen
V. Die frühere Rechtsprechung des BGH zur informellen (oder auch: gescheiterten oder einseitigen) Verständigung
VI. Die Entscheidung BGHSt 50, 40 ff. als Ausgangspunkt der Gesetzesreform
C. Das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren
I. Vorbemerkungen
II.Regelungsinhalt des § 257c
1. Übersicht
2. Grundsätzliche Zulässigkeit der Verständigung, § 257c Abs. 1 Satz 1
3. Keine Einschränkung der Aufklärungspflicht, § 257c Abs. 1 Satz 2
4. Mögliche Gegenstände einer Verständigung, § 257c Abs. 2
5. Bekanntgabe des Inhalts der Verständigung, § 257c Abs. 3 Satz 1, 2
6. Einbeziehung von Staatsanwaltschaft und Angeklagtem, § 257c Abs. 3 Satz 3, Satz 4
7. Voraussetzungen und Folgen der Abweichung vom Inhalt der Verständigung, § 257c Abs. 4
8. Belehrungspflicht, § 257c Abs. 5
III.Flankierende Vorschriften
1. Vorbemerkung
2. Absicherung der Öffentlichkeit der Verständigungsgespräche: §§ 243 Abs. 4, 267 Abs. 3, Abs. 4
3. Verständigung und Protokollierungspflichten, § 273 n.F. StPO, § 78 Abs. 2 OWiG n.F
4. Verständigung und Rechtsmittel: §§ 35a, 44 Satz 2, 302 n.F
D. Die Entscheidung des BVerfG vom 19.3.2013
I.Information
1. Übersicht
2. Verfassungsrechtliche Einordnung des VerstG
3. Folgerungen im konkreten Fall
II. Interpretation
III. Eigene Position
E. Gelöste, ungelöste und neu geschaffene Rechtsprobleme der Urteilsabsprache
I.Vorüberlegungen
1. Ausgangspunkt
2. Grobsichtung: Problemschwerpunkte
II.Probleme mit dem Inhalt der Verständigung
1. Eignung des Falles, § 257c Abs. 1 Satz 1
2.Gegenstände und Inhalt der Verständigung des § 257c Abs. 2
a) Übersicht
b)Seite des Gerichts: Rechtsfolgen als Urteils- oder Beschlussgegenstand
aa) Keine Vereinbarung einer Punktstrafe
bb) Strafaussetzung zur Bewährung
cc) Weitere Einzelfragen
c)Seite des Angeklagten
aa) Einleitung
bb) „Sonstiges Prozessverhalten“
cc) Verhalten der Verteidigung als Absprachegegenstand
d) Insbesondere: Qualität des Geständnisses
e)Seite der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage
aa) Seite der Staatsanwaltschaft
bb) Seite der Nebenklage
f)Ausdrückliche Verbote, § 257c Abs. 2 Satz 3
aa) Keine Absprache über den Schuldspruch
bb) Keine Absprache über Maßregeln der Besserung und Sicherung
III.Probleme mit dem Verfahren der Verständigung
1. Übersicht
2.Vorgaben des BVerfG zum Verfahren bei Verständigungen nach § 257c im Einzelnen
a) Übersicht
b) Verfahrensöffentlichkeit und Transparenz
c) Insbesondere: Protokollierungspflicht
d) So genannte Bindungswirkung und Belehrungspflicht
e) Verfahrensverstöße und Revision
f) Zwischenfazit
3.Das Verständigungsverfahren in der Rechtsprechung der Revisionsgerichte
a) Übersicht
b)Verfahrensöffentlichkeit und Transparenz
Читать дальше