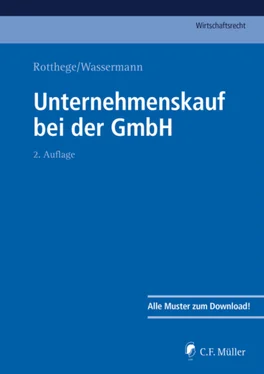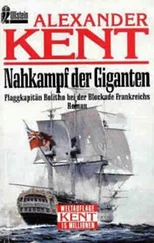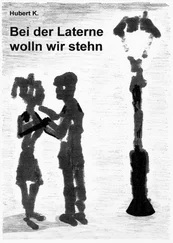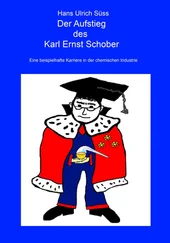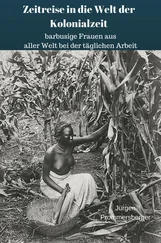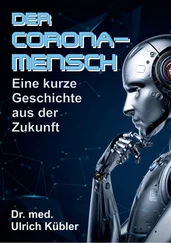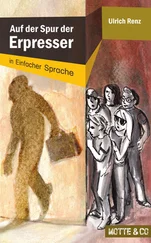229
Auch die Kostenstrukturist zu analysieren. Dabei kann man sich auf einige zu ermittelnde Kennzahlen beschränken. Wichtig ist die Analyse von Kosten aufgrund längerfristiger Verträge wie z.B. Personal, Miete und Leasing. Da die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge für eine Analyse des operativen Geschäfts nicht von großer Relevanz sind, werden sie in der Regel ausschließlich nach Auffälligkeiten und Besonderheiten durchgesehen.
230
Wesentlich ist, dass die historische Ertragslage um einmalige und nicht wiederkehrende Effekte bereinigt werden muss, damit die aus den Jahresabschlüssen ableitbare historische Profitabilität nicht verzerrt und nur eingeschränkt aussagefähig wiedergegeben wird.[5] Eine Kennzahl für die Profitabilität ist häufig das EBIT oder EBITDA.
231
Während die Analyse der Ertragslage dazu dient, die künftige Ertragskraft des Zielobjektes zu hinterfragen, geht es bei der Analyse der Vermögenslagein erster Linie darum, Risiken festzustellen, die in den Jahresabschlüssen nicht berücksichtigt sind. Es geht also um die Frage der Überbewertung von Vermögensgegenständen und der vollständigen Erfassung und „richtigen“ Bewertung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Auch die Identifizierung nicht betriebsnotwendigen Vermögens, das nach der Transaktion liquiditätswirksam veräußert werden kann bzw. noch durch den Altgesellschafter vor der Transaktion zu veräußern ist, ist Gegenstand der Analyse der Vermögenslage.
232
Da die Kaufpreis-Herleitung üblicherweise auf der Annahme eines cash and debt free-Unternehmens basiert, kommt - neben der Ermittlung von bilanziellen Risiken – den Nettofinanzverbindlichkeiten[6] eine besondere Rolle zu. Daher sind diese im Rahmen der Analyse der Vermögenslage sowie Working-Capital-Positionen zu identifizieren und zu quantifizieren.
|
Tätigkeiten |
Zielsetzung |
| Anlagevermögen |
– Angemessenheit der Nutzungsdauer – Herausarbeiten der Abschreibungsmethodik – Herausfiltern nicht betriebsnotwendigen Vermögens – Abgleich der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände mit den historischen Cash flows |
Ermittlung Reinvestitonsbedarf Ermittlung Erweiterungsinvestitionsbedarf Hinweise auf stille Reserven Hinweise auf Reparaturstaus Hinweise auf Sale & Lease back-Transaktionen |
| Working Capital |
– Analyse der Kundenstruktur – Analyse der Altersstruktur der Forderungen aus LuL – Herausfiltern von Forderungen mit Finanzierungscharakter (häufig bei verbundenen Unternehmen) – Analyse Altersstruktur und Umschlagshäufigkeit der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren – Analyse der Herstellungskosten bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen – Prüfung der Einhaltung des strengen Niederstwertprinzips beim Vorratsvermögen – Analyse der Altersstruktur der Verbindlichkeiten aus LuL – Überprüfung der Vollständigkeit und Angemessenheit der Rückstellungen |
Ermittlung von Kunden-Abhängigkeiten Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs und der Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen Eliminierung Forderungen aus Finanzvermögen Ermittlung von Überbeständen und Altwarenbei den Vorräten Ermittlung Bilanzpolitik bei Ausübung von Wahlrechten bei der Bewertung der Vorräte Ermittlung einzelner Deckungsbeiträge bei den unfertigen Erzeugnissen Eliminierung Verbindlichkeiten LuL mit Finanzierungscharakter Vollständigkeit der Rückstellung Ermittlung überdotierter Rückstellungen |
| Pensionsrückstellungen |
– Analyse der Pensionsordnung und der Einzelzusagen – Analyse des versicherungsmathematischen Gutachtens – Überprüfung Rechnungszins, Gehalt- und Rententrends |
Ermittlung tatsächliche Verpflichtung aus Pensionszusagen |
| Netto-Finanzverbindlichkeiten |
– Ermittlung aller verzinslichen Aktiva und Passiva, soweit sie nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen sind – Analyse der Leasingverpflichtungen |
Ermittlung der Werthaltigkeit von Darlehen und Ausleihungen Ermittlung der kurzfristigen Veräußerbarkeit der Ausleihungen Ermittlung zukünftiger Liquiditätsabflüsse aus Leasingverträgen |
[1]
Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 425.
[2]
IDW/Wagner/Russ Wirtschaftsprüfer-Handbuch, 2008, S. 1116.
[3]
Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 426.
[4]
Rotthege/Wassermann Mandatspraxis Unternehmenskauf, 2009, S. 71.
[5]
Pomp S. 26.
[6]
Liquide Mittel + Finanzvermögen – Finanzverbindlichkeiten.
II. Finanzwirtschaftliche Due Diligence
233
Schwerpunkt einer jeden financial Due Diligence ist die finanzwirtschaftliche Due Diligence. Sie befasst sich nicht – wie bei der bilanziellen Due Diligence – mit Ansatz- und Bewertungsfragen, sondern ist rein zahlungsstromorientiert und beschäftigt sich mit der Analyse der Finanzlage des Zielunternehmens.[1]
234
Ziele der finanzwirtschaftlichen Due Diligencesind zum einen die Ermittlung des Liquiditäts- und Finanzstatus des Zielunternehmens und zum anderen die Ermittlung verborgener finanzwirtschaftlicher Risiken, wie z.B. Nachzahlungsverpflichtungen, Haftungsverpflichtungen oder Garantieverpflichtungen, die zu einem unerwarteten Liquiditätsabfluss oder zu einer Finanzierungslücke führen können. Diese Risiken können im Kaufvertrag durch Garantien oder Gewährleistungen abgesichert werden oder haben Auswirkungen auf den Kaufpreis.
235
Das Analyseinstrument der finanzwirtschaftlichen Due Diligence ist schlechthin die Kapitalflussrechnung, in der die Ergebnisse auf cash flow-Ebene ermittelt werden. Grundlage für die Kapitalflussrechnung ist der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 21(„DRS 21“) in der aktuellen Fassung vom 22.9.2017.[2] Der Standard hat zwar keine Gesetzeskraft, gilt jedoch aufgrund der Bekanntmachung durch das BMJ als Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung für die Konzernrechnungslegung.[3] Die Kapitalflussrechnung bildet die Zahlungsströme der Periode ab, und zwar abgegrenzt nach den betrieblichen Tätigkeitsbereichen als Mittelzu- und Mittelabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle sind ausgeschlossen. Die einzelnen cash flows sind zusätzlich um einmalige, nicht wiederkehrende Effekte sowie um nicht im Zusammenhang mit dem gewöhnlichen operativen Geschäftsbetrieb stehende Effekte zu bereinigen.
236
Bei der Ermittlung des cash flows ist eine Einsichtnahme in die zugehörigen Konten des Jahresabschlusses unerlässlich, um die tatsächlichen Zahlungsströme nachzuvollziehen. Eine reine Veränderungsrechnung von Bilanzposten reicht nicht aus.
237
Der cash flow aus laufender Geschäftstätigkeitgilt als Indikator für die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens. Idealerweise sollte dieser cash flow die Neuinvestitionen sowie die Zahlungsansprüche der Kapitalgeber bedienen können.[4]
238
Da der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit eine der ausschlaggebenden Kennziffern für die Investitionsentscheidung der Investoren darstellt, muss bei der due Diligence ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Cashflows im Zeitablauf gelegt werden. Eine Steigerung resultiert nicht immer auf externen Einflussfaktoren wie z.B. die Absatzmarktsituation oder aus grundlegenden Umstrukturierungsmaßnahmen durch den Verkäufer, sondern kann auch durch sachverhaltsgestaltende Maßnahmen beeinflusst werden. Solche sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen können sein die Verkürzung des Zahlungszieles für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, eine plötzliche Verminderung des Vorratsbestandes oder die Inanspruchnahme von Finanzierungsmaßnahmen wie die Kreditsubstitute Factoring oder Asset Backed Securities.[5]
Читать дальше