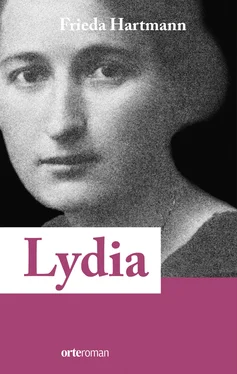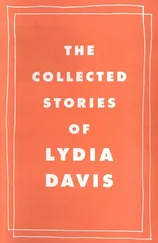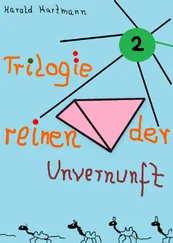«Fahr ab damit», befahl Otto hastig, «aber sofort!» Lydia wusste in ihrer fürchterlichen Aufregung nicht wo aus noch ein, schob sie ins Ofenrohr, riss sie wieder heraus, dann in den Küchenkasten.
«Aber nein, da kann der Vater sie sehen», herrschte Otto sie an.
«Ja, aber wohin denn?», fragte Lydia verzweifelt, denn schon kam der Vater gegen die Haustür, jetzt war er im Gang.
«Fahr doch ab!» Otto stampfte zornig und blies dann mit vollen Backen in die übervolle Milchpfanne hinein.
Lydia flitzte zur Tür hinaus, eben in dem Moment, als der Vater zur andern hereinkam, ein kurzer, bedauernder Blick traf den Inhalt der kleinen Schüssel, und wupps flog alles miteinander in den Jauchekasten. Gottlob, da unten würde der Vater die Beeren nicht sehen, und so harmlos als möglich trat sie einen Augenblick später in die Küche. Der Vater ging bald wieder. Diesmal war es ohne Schelten abgelaufen. Den eben aufgetragenen Kaffee schlug er aus, gab einige Befehle und entfernte sich.
«Wo hast du die Beeren?», fragte Otto, als der Vater ausser Hörweite war.
Lydia wurde rot und war dem Weinen nahe.
«Ich habe sie in den Jauchekasten geschmissen.»
Otto war erst sprachlos, dann überhäufte er sie mit Schmeichelnamen, doch Lydia wehrte sich energisch. «Du hättest es ganz sicher nicht besser gemacht, hast ja immer nur befohlen: ‹Fahr ab, fahr ab, es ist gleich wohin›, hättest mir ja raten können, wenn du gescheiter gewesen wärest.»
Wenig fehlte und die beiden wären sich in die Haare gefahren, daheim wär’s sicher nicht so glatt abgelaufen, hier aber waren sie zu sehr aufeinander angewiesen. «Wo hast du denn das Beckeli?», wollte Otto wissen.
«Das liegt halt auch drunten, es ist mir aus der Hand geschlipft», gestand Lydia kleinlaut.
«Guten Appetit!», sagte Otto und spuckte auf den Boden, die beiden sahen sich an und lachten, lachten, lachten, und das einfache Mittagessen schmeckte ihnen auch ohne Erdbeeren.
2
Wieder blühte der alte Kirschbaum hinter dem Hause, schon zum achten Mal seit Lydias Hirtenzeit, und auf der Wiese weideten die Kühe und Ziegen; aber statt der beiden Mädchen sass ein Bub dabei, den der Mattes auf den Hof genommen. Sonst schien die Zeit wenig geändert zu haben, die Ziegen waren naschhaft und wandersüchtig wie ehedem, und der kleine Geissbub hatte einen heillosen Respekt vor der Nachbarin, die noch jeden Frühling und Herbst die Geissen zum Kuckuck wünschte.
Trat man aber in die grosse, helle Stube, gewahrte man sofort eine Veränderung. Da, wo früher die Diplome für gute Viehzucht und Alpwirtschaft gehangen, hing jetzt das Bild der verstorbenen Mutter. Ja, sie war tot, die gütige, unscheinbare Frau, seit sechs Jahren schon. Im Hochsommer hatte sie sich hingelegt, nachdem sie schon lange so müde und matt gewesen war. «Mein Herz ist nicht mehr in Ordnung; ich muss einmal zum Arzt»; und zum erstenmal in ihrem Leben ging sie zum Doktor. Grosse Herzschwäche hatte die Diagnose des Arztes gelautet, nichts, gar nichts mehr schaffen, ruhen sollte sie. «Ruhen, ich? Nichts mehr schaffen? Zusehen, wie die andern jetzt im Hochsommer schinden und schaffen müssen? Nein, Herr Doktor, das kann ich nicht, es wird schon noch gehen.» Aber es ging nicht mehr. Niemand wollte dies glauben, nicht der Gatte, nicht die Kinder, am wenigsten aber sie selbst, die bis jetzt immer und immer nur an ihre Familie gedacht und für sie gelebt. Der Gedanke, dass die Mutter von ihnen gehen könnte, schien allen einfach unfassbar, und doch rückte das Ende mit jedem Tag, mit jeder Stunde näher, und keines konnte sich dieser fürchterlichen Wahrheit verschliessen.
Da war es wieder die Mutter, die sich zuerst durchgerungen, die die Ihren aufrichtete und tröstete, die trotz langen, langen Stunden der Todesnot nur darauf bedacht war, sie auf den rechten Weg zu weisen, um sie dereinst wiederzusehen. Eine Heldin war sie im Leben, eine noch grössere im Sterben; denn obschon sie sehen musste, wie nötig sie Mann und Kind noch wäre, sie fügte sich ohne Murren und Klagen in den Willen ihres Gottes und befahl ihre Familie seiner treuen Hut. Als dann die Sterbestunde nahte und die ganze Kinderschar um ihr Bett versammelt war, da legte sie auf jedes Kindes Haupt segnend die treuen Hände, mit einem Blick voll unendlicher Liebe umfasste sie die Ihren, und ein glückliches Lächeln umspielte die blassen Lippen der Sterbenden.
«Wie bin ich doch so glücklich», sagte sie, «mit keinem König tauschte ich, ihr alle habt mich lieb und werdet mich nie vergessen, und dereinst werde ich euch wiedersehen. Herrgott, lass keines meiner Kinder verlorengehen! Herr, hilf! Herr, stehe mir bei!» Ein kurzer Todeskampf, dann war’s vorbei. Eine einfache, schlichte Bauernfrau war aus dem Leben geschieden; aber im Herzen der Ihren lebte sie fort, und ob auch manches stürzte und strauchelte, verloren konnte keines gehen, denn das Gebet und der Segen einer frommen Mutter hat Riesenkräfte, die alle Zeiten überdauern.
*
Im weissen, gestickten Zwilchkittel, roter Scharlachweste und braunen Halbleinhosen, dem rotbraunen Samthut auf dem fast kahlen Kopf und dem selbstgeschnittenen Haselnussstecken in der sehnigen Faust, trat der Hof-Mattes aus seinem Hause. Er hatte wohl etwas gealtert, aber noch war sein Gang elastisch, und hell und scharf der Blick. Ein paar Schritte machte er, dann kehrte er um: «Lydia!» Kurz und herrisch wie früher klang seine Stimme. Am Fenster erschien eine schlanke Mädchengestalt. «Ja, Vater.»
«Es ist möglich, dass ich am Abend nicht heimkomme, vielleicht schlafe ich auf der Alp, schaut gut zur Sach. Leb wohl.»
«Leb wohl, Vater, komm bald wieder.» Lydia sah dem Vater nach, bis er um die Wegbiegung war, dann atmete sie tief auf, und in übersprudelnder Fröhlichkeit die Schwester umfassend, wirbelte sie in der Stube herum und sang: «Ist d’Katz us em Hus, so tanzet d’Mus.»
Lachend machte sich Anny frei. «Hast ein Rädlein zu viel oder freust dich so, dass dein Freund kommt?»
«Mein Freund?» echote Lydia, «ich denk, er ist der deine so gut wie meiner, oder eigentlich müssen wir sagen, Freund Max ist mir so lieb als Freund wie als Vetter.»
«Ob Hans uns nicht bald vergisst, wenn er in der Fremde ist», meinte Anny nachdenklich. Einen raschen Blick warf Lydia auf der Schwester ernstes Gesicht, dann lächelte sie zuversichtlich und froh.
«Wo denkst du hin, so ist denn doch Hans nicht, dies wär’ ja eine heitere Freundschaft; aber du, ich geh’ ein wenig hinter das Haus, komm mit!
«Geh nur, ich komme bald nach.»
«Bist etwa noch nicht hübsch genug für deinen Max?», neckte Lydia, machte sich aber gleich aus dem Staube, als sie den erzürnten Blick der Schwester sah. Spähend blickte sie nach der Anhöhe, wo die beiden herkommen sollten, denn sie kamen gewiss wieder zu Fuss; aber niemand zeigte sich. Mit einem wohligen Seufzer streckte sie sich auf dem Liegestuhl aus, und ihre Gedanken gingen zurück zu der Zeit, als ihr Vetter zum ersten Mal mit seinem Freunde erschienen war. Sie hatte sich bis dahin sehr wenig um die jungen Burschen bekümmert. Nicht dass ihr nicht dieser oder jener ein wenig gefiel; aber sie hatte trotz dem fröhlichen Übermut ihre ganz bestimmten Grundsätze, denen sie um jeden Preis treu bleiben wollte. Sie hatte sich fest vorgenommen, nie einen Mann zu küssen, bis sie sich verlobte, ihr Verlobungskuss sollte der erste sein, den sie verschenkte. Sie wollte ihre Liebe nicht vergeuden und verzetteln, bald an diesen, bald an jenen; nein, aufpassen wollte sie auf sich selbst und warten, bis der Rechte kam, und diesem allein sollte ihre ganze, grosse Liebe gehören, ungeschwächt.
O, sie hatte ein Ideal, die junge, fröhliche Lydia, niemandem verriet sie dies, aber so, ganz so, wie sie es meinte, sollte er einmal sein, gross, blond und stark, so stark, dass man sich ein bisschen vor ihm fürchten musste; lieb und gut, natürlich, aber manchmal, wenn sie ihm etwa trotzte, dann müsste er sie ganz fest und streng ansehen und sagen: «Da hindurch geht’s jetzt, Kleines», und sie, sie würde sich fügen müssen, eben weil er der Stärkere war.
Читать дальше