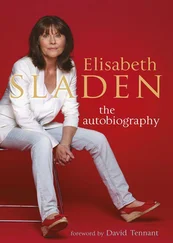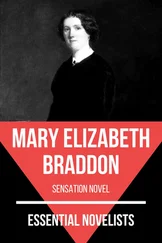Elisabeth Bürstenbinder - Herz-Sammelband - Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane
Здесь есть возможность читать онлайн «Elisabeth Bürstenbinder - Herz-Sammelband - Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Am Altar
Glück auf!
Gesprengte Fesseln
Vineta
Um hohen Preis
Frühlingsboten
Ein Gottesurteil
Die Alpenfee
Fata Morgana
Adlerflug
Hexengold
Der höhere Standpunkt
Der Lebensquell
Edelwild
Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die beiden jungen Männer schwiegen, aber das Erscheinen Rhaneck’s wirkte sehr verschieden auf sie. Ottfried, gewohnt sich der Autorität des Vaters zu fügen, hatte die Büchse gesenkt und war gehorsam einige Schritte zurückgetreten, Benedict stand noch immer da wie ein gereizter Löwe, die Waffe in der hocherhobenen Hand, das Auge sprühend und zwischen seine Brauen grub sich tief die verhängnißvolle Falte. Nicht auf der des Majoratserben, auf seiner Stirn stand der finstere Familienzug des Rhaneck’schen Geschlechts, stand jetzt auch die ganze Härte und Grausamkeit desselben: so mußte der Graf, so der Prälat aussehen, im Momente der höchsten Erregung; die eine Linie veränderte auf einmal den ganzen Charakter des Gesichts und zeichnete dort eine Aehnlichkeit, die sich sonst nie in der leisesten Spur verrieth.
Auch Rhaneck sah sie und trotz Zorn und Angst glitt doch eine Secunde lang ein Ausdruck von Stolz und Zärtlichkeit über seine Züge, aber sie wurden sofort wieder ernst, als er sich dem noch immer trotzig Dastehenden näherte.
„Bruno, was soll die Waffe in Deiner Hand?“ fragte er mit schwerer Betonung.
Der junge Priester zuckte zusammen, er verstand die Mahnung, stumm blickte er wieder auf sein Ordensgewand und langsam entsank das Messer seinen Händen.
„Ihr waret im Streite!“ begann der Graf von Neuem, „was war die Veranlassung dazu, wer von Euch hat ihn angefangen?“
Stumme Pause, keiner der Beiden regte sich.
„Bruno!“ er wendete sich vorwurfsvoll an diesen, „Du zum Mindesten hättest das bedenken sollen, was Du Deinem Stande schuldig bist. Ziemt dieser wilde Jähzorn dem geweihten Priester?“
Benedict blickte finster auf. „Legt mein Stand mir auch die Verpflichtung auf, zu dulden, daß Graf Ottfried ihn mir als eine Gnade seiner Familie vorwirft? zu dulden, daß er mir die Bedientenstelle hinter seinem Stuhle zuweist?“
Der Graf fuhr auf. „Ottfried, das hast Du gewagt?“ Ein Blick glühenden Zornes traf den Sohn, aber dieser hob jetzt auch trotzig das Haupt.
„Ich habe Herrn Pater Benedict an die Schranken erinnert, die er mir gegenüber vergessen hat!“
„Wenn Du wirklich diese Worte ausgesprochen hast, so wirst Du sie zurücknehmen und Bruno um Verzeihung bitten!“ befahl der Graf mit einer Härte, die wenig Väterliches hatte.
„Mein Vater!“
„Ottfried, Du wirst!“
„Nun und nimmermehr!“ rief Ottfried heftig und der Blick, den er dabei auf seinen Gegner schoß, war so voll Haß, daß der Graf einsah, er dürfe den Conflict nicht bis zum Aeußersten treiben. Er trat zu Benedict und legte die Hand auf dessen Arm.
„Ottfried ist jetzt zu gereizt, er wird sich besinnen und in einer ruhigen Stunde Dir die Abbitte leisten. Gieb Dich zufrieden, Bruno, ich sage Dir, es wird geschehen.“
Benedict zog kalt den Arm zurück. „Herr Graf ich verzichte auf eine erzwungene Genugthuung! Ich stand im Begriff, mir gegen eine Beleidigung selbst Recht zu schaffen, fremdem Einfluß mag ich es nicht danken.“
„Fremdem? Bruno!“
Der Vorwurf klang beinahe schmerzlich, aber der Graf richtete nun einmal nichts aus mit dieser Milde seinem Schützlinge gegenüber, in dessen Auge lag wieder der alte Widerwille, die geheime Abneigung, mit der er jede Annäherung, jede Zärtlichkeit, die von dieser Seite kam, zurückwies.
„Ich muß jetzt wohl wünschen, Sie wären mir fremd geblieben mit Ihrer Gnade und Ihren Wohlthaten, Herr Graf!“ sagte er hart. „Ich habe diese Wohlthaten von jeher gehaßt: sie wurden mir aufgezwungen, als ich noch ein Kind war, und als ich zum Bewußtsein erwachte, hatte man bereits Sorge getragen, daß mir jeder andere Lebensweg verschlossen blieb. Ich konnte und kann nichts von dem Empfangenen zurückzahlen, ich muß es zeitlebens als eine Schuld mit mir herumtragen, das ist auch eins von den gepriesenen Vorrechten meines Standes, der jede Selbstständigkeit vernichtet. Aber,“ hier brach eine heiße Bitterkeit mitten durch die erzwungene Ruhe, „aber ich wollte, Sie hätten mich nicht der Sphäre entrissen, für die ich geboren ward, ich wollte, Sie hätten mich zum Bauer, zum Tagelöhner werden lassen, der im Schweiße seines Angesichts das saure Brod verdienen muß, es wäre besser gewesen und ich hätte es Ihnen mehr gedankt, als dies Leben – am Altar!“
Ottfried hörte fast erstarrt zu, das schien ihm denn doch jedes Maß der Undankbarkeit und Unverschämtheit zu übersteigen, und sein Vater, an den sich all diese Beleidigungen richteten, der seine Gnade verschmäht, seine Wohlthaten mit Füßen getreten sah, Graf Rhaneck stand da, ohne sich zu regen, ohne auch nur mit einem Worte den wilden Ausbruch zu zügeln. Kein Zorn, nur eine immer zunehmende Angst sprach aus seinem Antlitz, als thue sich etwas Niegeahntes, Furchtbares vor ihm auf, und als Benedict die letzten Worte mit unverkennbarem Hasse herausschleuderte, da wendete er sich erbleichend ab und legte die Hand über die Augen.
Aber wenn irgend etwas im Stande war, Benedict zur Besinnung zu bringen, so that es dies stumme Abwenden, seine Lippen zuckten.
„Sie werden meine Undankbarkeit himmelschreiend nennen, und Sie thun Recht daran!“ sagte er ruhiger. „Ich habe nur Gutes von Ihnen empfangen und lohne Ihnen so dafür, es ist verdammungswerth, ich weiß es, aber ich kann nicht anders!“
Er neigte sich gegen den Grafen und wandte dann den Beiden den Rücken, Ottfried sah ihm nach, sah dann auf den Vater und schüttelte den Kopf, die Scene blieb ihm unbegreiflich.
„Papa, ist es möglich, das läßt Du Dir sagen! Du? – und schweigst dazu?“
Der Graf richtete sich auf, er hatte auf einmal seine ganze Energie wieder. „Schweig Du selbst, Ottfried!“ sagte er befehlend, „das sind Dinge, über die nur mir allein die Beurtheilung zusteht, aber vor Einem will ich Dich doch noch warnen. Du wirst Bruno nie wieder feindlich gegenübertreten, hörst Du? Niemals! Ich werde sorgen, daß es auch von seiner Seite nicht mehr geschieht. Wenn Ihr Euch nun einmal durchaus nicht vertragen könnt, so bleibt fern von einander, hassen dürft und sollt Ihr Euch nicht, und beleidigen,“ hier flammte sein Blick auf’s Neue drohend, „beleidigen wirst Du ihn nicht wieder, oder ich fordere Rechenschaft von Dir.“
Ottfried schwieg, aber zum ersten Male stieg ein argwöhnisches, grübelndes Nachdenken in ihm auf, welchen Grund denn sein Vater hatte, diesen seinen Schützling fortwährend mit einer Schonung und Nachsicht zu behandeln, die sonst keineswegs in seinem Charakter lag und deren sich der eigne Sohn fast niemals erfreute. Er und Benedict waren sich sonst stets fremd geblieben, nur in der Kinderzeit hatte man sie bisweilen zusammengeführt, und Ottfried hatte nie erfahren, wie weit die Fürsorge des Vaters für Jenen eigentlich ging. Jetzt zum ersten Male sah er sich gegen den Fremden offenbar zurückgesetzt, sah, wie mit augenscheinlicher Vorliebe für diesen Partei genommen ward, gegen ihn. – Was war es denn eigentlich mit diesem Benedict?
„Und jetzt komm!“ schloß der Graf hastig, als wolle er den Eindruck der eben durchlebten Scene verwischen, „laß uns nach Rhaneck zurückkehren, es ist hohe Zeit!“
Ottfried gehorchte, zuvor jedoch nahm er Benedict’s Spinoza von dem Feldsteine, auf dem er bisher gelegen, und schickte sich mit einiger Ostentation an, den Band in seine Jagdtasche zu stecken.
„Was hast Du da?“ fragte der Graf zerstreut.
„Die Lieblingslectüre des Herrn Pater Benedict!“ entgegnete Ottfried boshaft, ihm das Buch hinüberreichend.
Der Graf schlug den Titel auf und fuhr zurück. „Auch das noch! Allmächtiger Gott, was soll daraus werden!“
Er steckte das Buch zu sich und wendete sich dann kurz zu seinem Sohne. „Du schweigst gegen den Oheim, ich werde selbst mit Bruno darüber sprechen! Jetzt laß uns gehen.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.