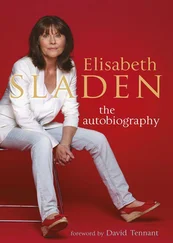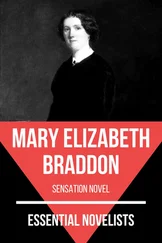Elisabeth Bürstenbinder - Herz-Sammelband - Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane
Здесь есть возможность читать онлайн «Elisabeth Bürstenbinder - Herz-Sammelband - Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Am Altar
Glück auf!
Gesprengte Fesseln
Vineta
Um hohen Preis
Frühlingsboten
Ein Gottesurteil
Die Alpenfee
Fata Morgana
Adlerflug
Hexengold
Der höhere Standpunkt
Der Lebensquell
Edelwild
Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Sie hielt den Fund noch geöffnet in der Hand, als ein Schatten auf die hellen Blätter fiel, Lucie blickte auf und fuhr mit einem leisen Schrei des Entsetzens empor. Da stand er wieder vor ihr, der finstere Mönch, der unheimliche Pater Benedict, und sah sie mit seinen großen dunklen Augen an. Sie wich zurück, so weit als es die Felswand nur gestattete, die Linke griff wie Schutz suchend in die grünen Ranken, während sie mit der Rechten das Buch mechanisch an sich preßte. Sie wußte jetzt freilich, daß es nicht der Währwolf im Märchen war, sondern ein Mensch von Fleisch und Blut, ein Geistlicher des Stiftes, aber das half alles nichts, es legte sich ihr genau so angstvoll und beklemmend auf’s Herz, wie das erste Mal. Hier war kein Entrinnen möglich, er stand ihr dicht gegenüber und jetzt öffnete er gar die Lippen zu einem Worte, jedenfalls so finster und feindselig, wie seine ganze Erscheinung war.
„Ich bitte um Verzeihung, wenn ich Sie erschreckt habe, mein Fräulein! Ich kehrte um, etwas Vergessenes zu holen, Sie sahen mich nicht, als ich über die Wiese schritt.“
Es war das erste Mal, daß Lucie seine Stimme vernahm, sie athmete tief auf und ließ die Hände sinken. Die Stimme klang ganz anders, als sie geglaubt, es war ein weicher voller Klang, der sympathisch ihr Ohr berührte, und als sie etwas ermuthigt dadurch einen Blick in sein Gesicht wagte, da erschienen ihr auch die Augen ganz anders, als sonst. Sie blickten wohl noch ernst und düster auf sie hin, aber die unheimliche Gluth darin war gemildert, war tief zurückgedrängt. Luciens Angst begann zu weichen, sie machte allmählich der entgegengesetzten Empfindung Platz. Nichts lag dem Charakter des jungen Mädchens ferner, als eigentliche Furchtsamkeit; im Gegentheil, sie war meist nur allzu keck und übermüthig. Wie oft war sie lachend und spottend Dem entgegengetreten, was Anderen als eine Gefahr erschien; wie oft hatte sie dem drohenden Stirnrunzeln von Madame Schwarz und den Strafpredigten von Fräulein Reich die Stirn geboten, wie oft sogar dem Zorn des Bruders getrotzt, den doch ganz Dobra fürchtete; warum hatte denn nur dieser Mann allein auf der ganzen Welt die Macht, sie durch seinen bloßen Anblick schon zu schrecken und zu ängstigen? Der Zorn darüber wallte heiß in ihr empor, sie wollte sich nicht mehr schrecken lassen, sie wollte der lächerlichen Furcht Herr werden, um jeden Preis! Entschlossen gab sie ihre Vertheidigungsstellung auf, warf die Locken zurück und trat einen Schritt vorwärts.
Jetzt erst bemerkte Benedict das Buch, das sie noch immer festhielt, und etwas, das beinahe einem Lächeln glich, flog über seine Züge.
„Was soll denn Spinoza in Ihren Händen?“ fragte er halb mitleidig, halb vorwurfsvoll, „für Sie passen doch solche Schriften sicher nicht!“
Er hätte Luciens heroischen Entschluß nicht wirksamer unterstützen können, als durch diese Bemerkung; wo ihr kindisches Selbstgefühl verletzt ward, trat für sie alles Andere in den Hintergrund. Sie fand sich tief gekränkt durch diese Worte, sie klangen aber auch gar zu mitleidig herablassend, ihr Zorn schlug in hellen Flammen auf, und ihm den Vorwurf sofort zurückgebend, entgegnete sie sehr entschieden:
„Nun, für Sie paßt das Buch doch wohl noch viel weniger!“
Benedict wich einen Schritt zurück bei diesem ganz unerwarteten Ausfall und sah sie halb erstaunt an. „Weshalb?“ fragte er endlich.
„Weil Sie ein Mönch sind!“ erklärte Lucie, genau den verächtlichen Nachdruck auf das Wort legend, mit dem ihr Bruder es auszusprechen pflegte.
Benedict zuckte leise zusammen. Fort war auf einmal der mildere Ausdruck der Züge, der alte Schatten und die alte Feindseligkeit standen wieder drohend dort und auch die Stimme hatte den weichen sympathischen Klang verloren, als er finster fragte:
„Sie verachten wohl die Mönche recht sehr?“
Lucie fühlte unklar, daß sie mit ihrem Worte irgend eine dunkle Tiefe aufgerissen, die besser verschlossen geblieben wäre, aber sie kämpfte schon wieder gegen die alte Angst an, die sich auf’s Neue zu regen begann, und in ihrem Widerstande dagegen ging sie schleunigst in’s Extrem über, und reizte nun selbst den Gefürchteten nach Kräften.
„Ich mag sie auch nicht!“ erklärte sie mit der ganzen Freiheit und der ganzen Unart eines Kindes, „und ich kann überhaupt nicht begreifen, wie ein Mensch es vermag, sich sein Leben lang im Kloster einzusperren und seine Zeit immer nur mit Beten und Büßen hinzubringen, während draußen die Welt so schön ist!“
Benedict lächelte wieder, diesmal aber lag eine unendliche Bitterkeit in seinem Lächeln.
„Sie können es auch nicht begreifen, weil Sie in Freiheit erzogen und aufgewachsen sind. Hätte man Sie schon als Kind mit Leib und Seele in die Gewalt der Priester gegeben, so wären Sie auch in’s Kloster gegangen. Ich sage Ihnen, Sie hätten es gethan!“ wiederholte er nachdrücklicher, als sie eine heftige Bewegung machte, „unter der eisernen Zuchtruthe bricht jeder Trotz und jede Willenskraft, unter ihr lernt sich Alles, und wenn es auch dem ganzen Wesen des Menschen im tiefsten Innern widerstrebt!“
Es bebte wie dumpfer, mühsam verhaltener Groll aus diesen Worten, aber Lucie geriet förmlich außer sich darüber. Ihr zu sagen, sie wäre auch in’s Kloster gegangen! Der Mann schien eine ganz eigenthümliche Vorstellung von seiner priesterlichen Gewalt zu haben, am Ende versuchte er noch gar, die „Zuchtruthe“ auch gegen sie geltend zu machen, sie erwartete nichts Geringeres, als einen vollständigen Bekehrungsversuch.
Aber nichts dergleichen erfolgte. „Wollen Sie mir jetzt mein Eigenthum zurückgeben?“ fragte Benedict nach einer augenblicklichen Pause wieder vollkommen ruhig.
Stumm reichte ihm Lucie das Buch hin, dabei berührte seine Hand einen Moment lang die ihrige, sie zuckte unwillkürlich zurück, er bemerkte es.
„Sie fürchten sich vor mir?“ fragte er leise.
Das junge Mädchen antwortete nicht.
Benedict trat rasch einige Schritte zurück, so daß ein weiterer Raum zwischen ihnen blieb; das eben noch geforderte Buch fiel unbeachtet zu Boden.
„Sie brauchen mich doch wahrlich nicht zu fürchten!“ sagte er bitter. „Ich werde selten genug in Ihren Gesichtskreis kommen. Ein so frohes, sinniges Schmetterlingsdasein und meine Bahn, die liegen allzuweit von einander – hoffentlich berühren sie sich nie!“
Das war doch nun entsetzlich beleidigend und rücksichtslos! Als ob Lucie diese Begegnung gesucht oder gewünscht hätte, als ob sie sie nicht noch ängstlicher mied als der Herr Pater, der so entschieden hoffte, mit ihr nie wieder in Berührung zu kommen! Das war ihr allzuviel, sie brach in vollste Heftigkeit aus.
„Ja, das hoffe ich gleichfalls! Ich weiß ja, daß Sie Alles hassen, was Freude und Sonnenschein heißt, und daß Sie vor allen Dingen mich hassen, ich habe es deutlich genug gesehen!“
Eine tiefe Gluth überdeckte auf einmal Benedict’s Züge, während er den Blick fest auf sie richtete.
„Wo haben Sie das gesehen?“
„Vorgestern auf dem Feste des Baron Brankow! O, und ich nicht allein!“ Lucie war jetzt einmal im Zuge, und nun fiel es ihr auch nicht ein, sich noch irgend einen Zwang aufzuerlegen. „Graf Rhaneck hat es auch bemerkt, wie feindselig Sie uns im Tanze beobachteten; er sagte, Sie sähen aus, als wollten Sie uns Beide in die fernsten Tiefen der Verdammniß schleudern!“
Die dunkle Gluth lag noch immer heiß auf Benedict’s Antlitz, sie schien noch tiefer zu werden bei den letzten Worten, unverwandt blickte er das junge Mädchen an.
„Also auch Graf Rhaneck!“ sagte er bitter. „Ja freilich, dessen Beobachtungen sind auf jeden Fall unfehlbar, zumal für Sie! Sie haben vollkommen Recht, mein Fräulein! Verabscheuen Sie in mir immerhin den finstern Fanatiker, der Ihnen keine Freude und keine Jugendlust gönnt, hassen Sie ihn nach Kräften – es ist am besten so!“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Herz-Sammelband: Elisabeth Bürstenbinder Liebesromane» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.