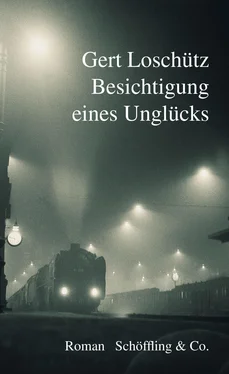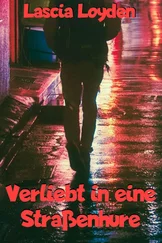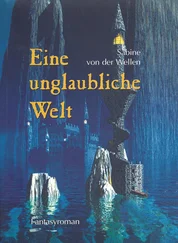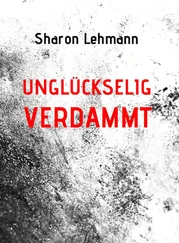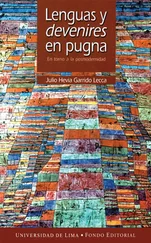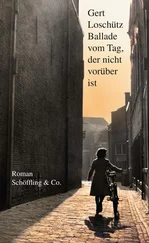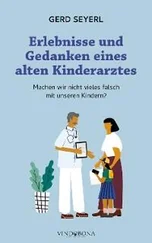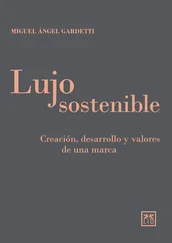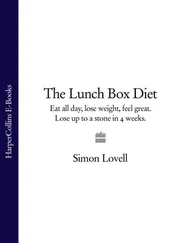*
Wernicke und Krollmann, beide aus Magdeburg. Wernicke aus Sudenburg, Krollmann aus Buckau. Von keinem ist eine Beschreibung überliefert, nur diese fleischlosen Sätze, mit denen sie die Schuldvorhaltungen abzuwehren versuchten, und doch kommt es mir vor, als sei Wernicke, der Ältere, zugleich der Größere gewesen, ein massiger Mann, der mit seiner Gewalt den Heizer beiseitezuschieben pflegte, ein Polterer mit glattrasiertem Gesicht, in dessen Nackenfalten Ablagerungen von Ruß zu finden waren, egal, wie gründlich er sich auch wusch, wie viel Seife er auch auf den Lappen gab, wie fest er auch rieb … um die Falten zu glätten, beugte er den Kopf vor, schrubbte dann den Nacken, aber wenn er den Kopf wieder hob, entstanden die Falten erneut, und damit war auch der Dreck wieder da. Zwei schwarze Rußstreifen zwischen drei roten Fettrollen.
Krollmann dagegen: ein Leichtgewicht mit flatternden Hosen, die von einem viel zu langen Gürtel am Rutschen gehindert wurden. Täglich fanden sich in der ihm von seiner Frau mitgegebenen Messingbüchse neben den Broten drei Pferdefleisch-Buletten, von denen eine für Wernicke bestimmt war, dazu ein Gläschen Mostrich aus Bautzen und, sommers, zwei aufgeschnittene Äpfel.
Sein Platz im Führerhaus war links. Wenn er nicht mit dem Feuer beschäftigt war, hatte er (insbesondere beim Rangieren, bei Fahrten mit dem Tender voran oder beim Bahnhofsdurchqueren) die linke Streckenseite im Auge zu behalten. Er stand am linken Fenster, Wernicke am rechten; beide achteten auf die Signale. Wer ihre Stellung zuerst aufnahm, rief sie dem anderen zu, und dieser wiederholte den Ruf, sobald er sie ebenfalls erkannte.
So war es vorgeschrieben.
Sie fuhren seit einem Vierteljahr zusammen, werden sich aber schon vorher gekannt haben. Tach, Wernicke! Tach, Krollmann! Jeder tippte an den Schirm seiner Mütze und ging weiter. Jetzt waren sie zusammengespannt. Ja, so kann man es nennen. Nirgends aber ein Hinweis darauf, dass sie darüber hinaus Umgang pflegten, auch privat. Sie fuhren zusammen und gingen danach ihrer Wege. Wernicke kehrte nach Sudenburg zurück, Krollmann nach Buckau.
Am Tag davor, dem vorm Unglück, endete ihr Dienst abends gegen acht. Ihre Unterkunft lag auf dem Gelände des Rangierbahnhofs. Nachdem sie sich gewaschen und umgezogen hatten, knöpften sie ihre Joppe zu, schlugen den Kragen hoch, klemmten die Tasche unter den Arm und traten auf die Straße hinaus.
Nach Sudenburg brauchte Wernicke ungefähr eine Stunde. Gegen neun kam er zu Hause an, schloss die Tür auf und stieg zu seiner Wohnung hinauf. Ich kenne das Haus. Nach meinem ersten Besuch im Archiv bin ich hingefahren und in der Wolfenbüttelerstraße, in der er wohnte, auf und ab gegangen, es war ein dreistöckiges Gebäude mit zwei übereinanderliegenden Erkerzimmern, von denen das obere zur Wernickeschen Wohnung gehört haben muss.
Was dann geschah, klingt in der Protokollsprache, in die seine Aussage übersetzt wurde, so: Ich habe Abendbrot gegessen und mich noch etwas mit meiner Familie unterhalten. Nachdem die 22-Uhr-Nachrichten im Radio zu Ende waren, habe ich mich zu Bett gelegt. Ich habe bis acht Uhr gut durchgeschlafen. Ich bin dann aufgestanden, habe gefrühstückt und bin zu Fuß wieder nach meiner Dienststelle gegangen, wo ich um elf Uhr ankam und Krollmann traf.
Es ist der Tag, an dem in Berlin vierzehn und in den Außenbezirken sechzehn bis achtzehn Grad minus gemessen werden. Und an dem die Sonne am Nachmittag um 15 Uhr 48 untergeht, während der Mond schon seit 12 Uhr 50 am Himmel steht.
Der Tag verlief, wie im Dienstplan vorgesehen: Fahrt nach Braunschweig, Herausdrücken des Zugs aus dem Bahnhof, Aufnahme von Kohle und Wasser, Reinigen des Feuers und Besanden der Lok. Anschließend Fahrt zur Untersuchungsgrube, um die Lok auch von unten zu revidieren.
Nachdem auch das erledigt war, gingen sie zu ihrer im Betriebswerk gelegenen Unterkunft. Krollmann machte sich lang (wie er sagte), Wernicke setzte sich an den Tisch und füllte Reparaturzettel aus. Das war nichts Besonderes. Das hieß nicht, dass ihm etwas aufgefallen wäre, was die Fahrtüchtigkeit der Lok beeinträchtigt hätte. Was er festhielt, waren kleinere Schäden, wie sie jederzeit auftraten, Undichtigkeiten, die sich nur im kalten Zustand der Maschine beseitigen ließen. Um sie nicht zu vergessen, notierte er sie auf verschiedene Zettel und legte sie in eine Mappe.
»Danach hab ich mich noch eine Viertelstunde lang gemacht.«
Auch er benutzte diesen Ausdruck.
Am frühen Abend Fahrt nach Berlin, wo sie, bei Einhaltung des Fahrplans, um 20 Uhr 21 hätten ankommen sollen, aber da ihre Abfahrt von Braunschweig ohne ihre Schuld mit großer Verspätung erfolgte, passieren sie um diese Zeit herum gerade das Stellwerk Genthin Ost, die Bude 89 und die Blockstelle Belicke.
Normale Fahrt. Gute Sicht, kein Nebel.
Nach ihrer Ankunft am Potsdamer Bahnhof wieder die obligatorischen Arbeiten: Reinigen der Maschine, Wasser und Kohle nehmen. Als Letztes fahren sie die Lok auf die Drehscheibe und bringen sie in die neue Fahrtrichtung: Westen.
Danach gehen sie zu ihrer Unterkunft, eine langgestreckte Holzbaracke.
Beim Nehmen der Kohle passiert etwas, worüber Krollmann später in aller Ausführlichkeit reden wird: Sie erhalten keine Lagerkohle, sondern frische aus der Lore, und zwar westfälische.
»Meistens ist die Lagerkohle so ausgetrocknet, dass sie nicht denselben Heizwert besitzt wie frische. Westfälische Kohle ist die beste, noch besser als die schlesische, die stückereicher und härter ist und deshalb ebenfalls schnell verbrennt. Ich weiß genau, dass wir westfälische Kohle erhalten haben.«
Am Nachmittag im Archiv, als ich Krollmanns Äußerungen zum ersten Mal las, glaubte ich, es sei die Begeisterung für seinen Beruf, die ihn so ausführlich über die Kohle sprechen ließ, bis mir klar wurde, dass sie Teil seiner Verteidigungsstrategie waren. Er wollte sagen, dass er wegen der schnell verbrennenden Kohle keine Zeit hatte, auf die Signale zu achten. Er konnte von seinem Führerstandfenster aus nicht, wie vorgeschrieben, die Strecke im Auge behalten, sondern musste Kohle nachwerfen.
Die schnell und hell brennende.
Die Lok steht jetzt in Fahrtrichtung im Schuppen, das heißt, mit der Spitze in Richtung Genthin, mit dem Tender zum Bahnhof, in dem zur selben Zeit, zu der sie ihre Brote auspacken, die beiden anderen ihre Maschine vor den Zug spannen. Die beiden anderen? Ernst und Stuck, Lokführer und Heizer des D 10, die, nähme man das Entsetzliche sportlich, die andere Mannschaft bildeten.
Ihr Zug wird von Gleis 2 abfahren.
Der Zug von Wernicke und Krollmann von Gleis 1.
Bis zur Abfahrt von Ernst und Stuck, die zuerst auf die Strecke gehen, bleiben noch fünfundzwanzig Minuten.
Dies ist der Moment, in dem die Abläufe ineinanderzugreifen beginnen. Keiner weiß es, die Katastrophe ist noch nicht sichtbar. Aber für einen Moment sind alle, die daran teilhaben werden, am selben Ort versammelt.
*
Der Potsdamer Bahnhof ist der älteste der Stadt. Gelegen am Endpunkt der Strecke nach Potsdam, die 1838 eröffnet und 1846 bis nach Magdeburg weitergeführt wurde, war es zunächst ein beinahe ländlich anmutendes Gebäude von den bescheidenen Ausmaßen eines märkischen Gutshauses, an dessen Stelle zwischen 1868 und 1872 ein neues errichtet wurde. Ein Prachtbau, der mit seinen klassizistischen Säulen, Bögen und Ornamenten von außen eher an ein Museum oder Theater erinnerte als an einen Bahnhof. Und doch war er genau das. Ein Kopfbahnhof mit zwei Mittelgleisen und acht Zugängen in der Bahnsteigmitte und an beiden Seiten, über dem sich ein Glasdach wölbte.
Die drei Schalterhallen befinden sich im Zwischengeschoss. Die Wände sind weiß gefliest, und das Abschlussgesims besteht aus roten und schwarzen Keramiksteinen. Die Treppenwände sind aus poliertem Muschelkalk. Die trichterförmigen Lampen hängen an langen Kabeln von den quer durch die Halle gespannten Stahlverstrebungen. Die Wartebänke stehen mit der Rückenlehne zu den Absperrgittern. In den Rundbögen über dem Ausgang hängen Reklametafeln für Boenicke-Zigarren, an einer Säule das lachende Gesicht des Sarottimohren. Ein Mann schiebt einen mit Milchkannen beladenen Karren vorbei.
Читать дальше