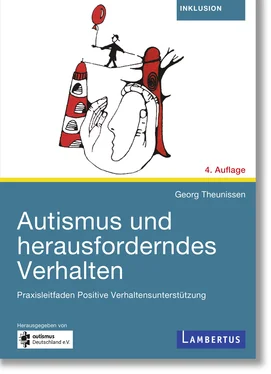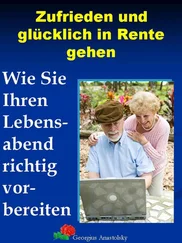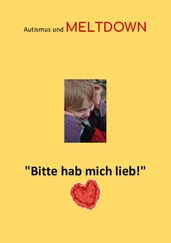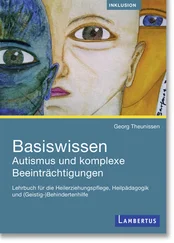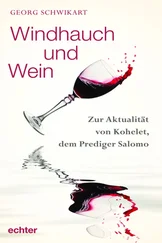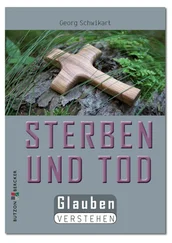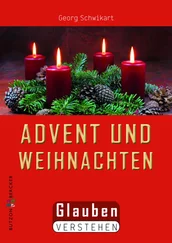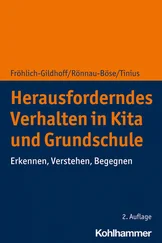Schaut man sich die heutige „Autismus-Landschaft“ an, kann man zu dem Schluss kommen, dass im Vergleich zu den Erkenntnissen und Praktiken der 70er und 80er Jahre des vorausgegangenen Jahrhunderts, also vor 30 bis 40 Jahren, heute wahrlich traumhafte Zustände in der Versorgung autistischer Menschen herrschen. Dies ist, was die therapeutische Versorgung autistischer Menschen angeht, ein Verdienst vieler Eltern, die sich, vereint im Bundesverband autismus Deutschland e. V., für die therapeutische Versorgung ihrer Kinder stark gemacht haben und z. T. den Mangel in der Versorgung dadurch abstellten, dass sie eigene Therapiezentren gründeten. Heute feiern viele dieser Zentren und Elternvereine bereits ihr 25., 30. oder 45. Gründungsjubiläum. Sie können mit Dankbarkeit auf viele Meilensteine, sowohl in der Entwicklung ihrer eigenen Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung als auch in den von ihnen gegründeten Einrichtungen und Angebote, zurückblicken.
Parallel dazu hat in der Gesellschaft und damit auch in der Pädagogik ein „Paradigmenwechsel“ stattgefunden, sodass heute dank vieler differenzierter Methoden ein weitaus positiverer und kompetenzorientierterer Blick auf Menschen mit Autismus geworfen wird.
Den Autor dieses Buches möchte ich ausdrücklich als Vertreter dieses Paradigmenwechsels hervorheben. Herr Professor Theunissen steht unserem Bundesverband, wenn es sein muss, durchaus auch kritisch gegenüber und mahnt uns beharrlich, den Menschen mit seinen Möglichkeiten und weniger die Defizite und Diagnosen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Häufig fällt genau das schwer, gerade wenn es um den Umgang mit massiv herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Autismus geht, welches von der Person zu trennen ist. Mit Wissen über die Besonderheiten des Autismus, einer Strukturierung des Alltags und einer am Menschen orientierten Pädagogik ist dem unverständlichen Verhalten des Gegenübers auf positive und konstruktive Weise zu begegnen. Das ist ein Teil des angesprochenen Paradigmenwechsels.
Maria Kaminski
Vorsitzende des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.
Autismus nimmt in den letzten Jahren immer mehr zu. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass der Anteil autistischer Menschen an der Gesamtbevölkerung bei etwa 1 Prozent liegt. Das betrifft in Deutschland ungefähr 800.000 Menschen im Autismus-Spektrum. Von diesen Personen sind aber längst nicht alle als autistisch diagnostiziert. Insofern haben wir es weniger mit einem „realen“ Anstieg an autistischen Menschen zu tun. Vielmehr handelt es sich um einen „Nachholeffekt“, der mit einer genaueren Diagnostik, mit besseren Kenntnissen und häufig mit einer Beseitigung von bisherigen Fehldiagnosen einhergeht. Dass Autismus keine seltene Erscheinungsform ist, hatte bereits Hans Asperger erkannt: „Wenn wir die charakteristischen Manifestationen von Autismus genauestens studieren, stellen wir fest, dass sie keineswegs selten sind“ (zit. n. Steve Silberman 2015, S. 82).
Demgegenüber betrachtete Leo Kanner Autismus als ein eher seltenes Syndrom. Beide Autoren gelten als „Erstbeschreiber“ von Autismus. Während Leo Kanner von einem „engeren Bild“ ausging, beschrieb Hans Asperger eine breiter angelegte Symptomatik. Nach Erkenntnissen der weltweit bekannten britischen Autismusforscherin Lorna Wing war das Modell von Hans Asperger valide und tragfähiger. Vor diesem Hintergrund gab sie der Autismusforschung wichtige Impulse, Autismus im Rahmen eines Spektrums zu betrachten und zu erfassen.
Heute wissen wir, dass es zwischen dem Autismus-Bild von Leo Kanner und dem von Hans Asperger beschriebenen Syndrom mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Ebenso wissen wir, dass die meisten Menschen aus dem Autismus-Spektrum keine kognitiven Beeinträchtigungen im Sinne einer sogenannten geistigen Behinderung haben. Ferner haben alle autistischen Personen spezifische Stärken, und viele von ihnen zeigen Spezialinteressen und besondere Fähigkeiten. Daher gilt es ihre „autistische Intelligenz“ zu erkennen, zu würdigen und zu unterstützen. Das war viele Jahre nicht selbstverständlich. Heute wissen wir, dass mit der sogenannten Stärken-Perspektive der wohl beste Weg zu mehr Lebensqualität für autistische Personen geebnet werden kann.
Gleichwohl ist es wichtig, Autismus nicht nur im Lichte von Stärken zu betrachten. Ebenso wichtig ist es, Probleme mit in den Blick zu nehmen, die mit Autismus einhergehen. Das betrifft zum Beispiel verschiedene Besonderheiten in der Wahrnehmung, in der Motorik, in der sprachlichen Kommunikation und in der Interaktion mit anderen Menschen.
Heute wissen wir, dass vor allem eine biologisch bedingte erhöhte Reizempfindlichkeit autistischer Menschen Stress und Ängste erzeugen kann, die es zu bewältigen gibt. Hierbei kommt es häufig zu Verhaltensweisen, die als herausfordernd wahrgenommen werden. Das betrifft zum Beispiel Wutanfälle, Schreien, Schlagen, Wegrennen, sich selbst mit dem Kopf schlagen oder sich zurückziehen und abkapseln. Solche herausfordernden Verhaltensweisen wurden viele Jahre unmittelbar mit Autismus in Verbindung gebracht. Oft wurden sie als Ausdruck von Autismus betrachtet. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um Verhaltensreaktionen auf bestimmte Situationen, die für die betreffende autistische Person unerträglich sind. Darauf hatte schon Grunja Evimovna Ssucharewa aufmerksam gemacht. Ihr Verdienst ist es, schon vor L. Kanner und H. Asperger eine sogenannte funktionale (verstehende) Problemsicht im Zusammenhang mit Autismus angedacht zu haben.
Heute wissen wir, dass es zum Verständnis von Autismus wichtig ist, zwischen autistischen Merkmalen und Verhaltensreaktionen zu unterscheiden. Von zentraler Bedeutung ist die funktionale Sicht autistischen Verhaltens und Erlebens sowie der Reaktionen auf bestimmte Situationen. Sie bietet die Chance, nicht nur Menschen aus dem Autismus-Spektrum besser zu verstehen, sondern ihnen zugleich auch Unterstützung zur Bewältigung von Problemen anzubieten. Zudem trägt die funktionale Sicht zu einem angemessenen Umgang mit autistischen Menschen bei. Das gilt vor allem für den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen.
Gerade herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Autismus-Spektrum stellen vor allem für nicht-autistische Bezugspersonen oder Mitmenschen eine hohe Belastung dar. Als besonders belastend werden insbesondere stark ausgeprägte autistische Merkmale und zusätzliche (schwere) kognitive Beeinträchtigungen (geistige Behinderung), schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten oder Begleiterscheinungen (z. B. ADHS, Depressionen, Angst-, Zwangs- oder Essstörungen) wahrgenommen.
Daher ist der Wunsch nach Hilfe oder einer angemessen Unterstützung groß. Hierzu gibt es mittlerweile zahlreiche therapeutische oder pädagogische Konzepte und Vorschläge. In der vorliegenden Schrift geht es diesbezüglich ausschließlich um spezielle pädagogische Maßnahmen.
Spezielle pädagogische oder sogenannte pädagogisch-therapeutische Maßnahmen beziehen sich in erster Stelle auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten. Fragen des Umgangs mit herausfordernden Verhaltensweisen bei Autismus stehen somit im Vordergrund. Folglich geht es nicht um Fragen des Umgangs mit eng umschriebenen Begleiterscheinungen oder zusätzlichen psychischen Störungen wie zum Beispiel ADHS, Depressionen, Angst-, Zwangs-, Ess- oder Schlafstörungen.
Mehrere Studien und Forschungsarbeiten aus dem angloamerikanischen Raum lassen den Schluss zu, dass es derzeit nur wenige umfassende pädagogisch-therapeutische Konzepte gibt, die im Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Autismus als Erfolg versprechend eingeschätzt werden dürfen. Das gilt vor allem für die Positive Verhaltensunterstützung (PVU). Sie stammt unter der Bezeichnung positive behavioral support (PBS) ursprünglich aus den USA und wurde hierzulande im Rahmen eines Gesamtkonzepts verfeinert und weiterentwickelt.
Читать дальше