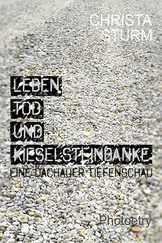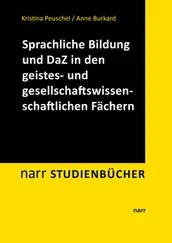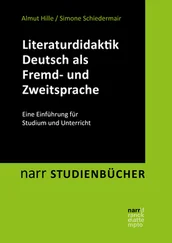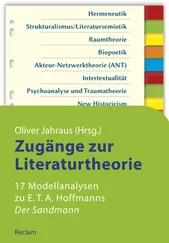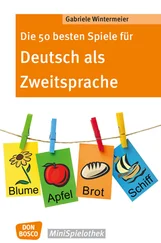Während Befürworter:innen der nativistischen Theorienativistische Theorie der Interaktion mit der Umwelt und dem konkreten Sprachangebot der Umgebung eine geringe Bedeutung beimessen, rücken gerade diese Aspekte in der gebrauchsbasierten ( usage-based ) Spracherwerbskonzeption in den Vordergrund (u.a. Tomasello 2003, 2006; Behrens 2009, 2011). Gebrauchsbasierte Spracherwerbstheoriengebrauchsbasierte Spracherwerbstheorien wie die des Anthropologen und Verhaltensforschers Michael Tomasello modellieren Spracherwerb grundsätzlich nicht als isolierten kognitiven Prozess; stattdessen sind übergreifende Kompetenzen von Einfluss. Das bedeutet, als angeboren gelten nicht das grammatische Wissen, sondern Fähigkeiten der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit, des Denkens, des Lernens, des sozialen Verhaltens ‒ Fähigkeiten, die im komplexen Zusammenspiel und bei entsprechendem Umweltangebot den Erwerb von Sprache (inklusive grammatischen Wissens) ermöglichen.1
Wie die Bezeichnung ‚gebrauchsbasiert‘ bereits andeutet, sind der Gebrauch von Sprache (die Performanz, siehe Kap. 1.2) und damit die situationsbezogene sprachliche Verständigung zwischen Kommunikationspartner:innen bzw. die intendierten (nicht zufälligen) sprachlichen Handlungen in Kommunikationssituationen für den Erwerb zentral. Sie bieten dem Kind die Basis, bei Wiederholung gleicher Sprachhandlungen/Äußerungen in ähnlichen Situationen sprachliche Verwendungsmuster zu erschließen. Ausschlaggebend ist dabei der Versuch, die Intentionen für die Äußerungen zu ergründen und diese auch nachzuahmen. Durch wiederholtes Hören und Verwenden von Äußerungen mit leichter Variation (z. B. ich will Eis, ich will Pommes, ich will Cola, …) wird ein Prozess der Schematisierung und AnalogiebildungAnalogiebildung bzw. MusterfindungMusterfindung eingeleitet, der langsam zum Erwerb des L1-spezifischen grammatischen Wissens führt.
Ein Muster oder Schema ist in diesem Fall eine bestimmte (regelmäßige) Ordnung des Strukturaufbaus: Beim Beispiel ‚ ich will Eis, ich will Pommes, … ‘ ist der jeweils erste Teil der Äußerungen gleichgestaltet, am Schluss kommt ein variables Element, das mit unterschiedlichen Ausdrücken (Zielobjekten des Haben-Wollens) gefüllt werden kann (‚ich will X‘). Kontrastiert man ‚ ich will Eis ‘ mit ‚ du willst Eis ‘, ‚ wir wollen Eis ‘, ließe sich die Schematisierung auf eine noch abstraktere Ordnungsebene heben, wobei der Bedeutungszusammenhang ‚Person möchte X in ihren Besitz bringen‘ mit der grammatischen Struktur ‚NP Subjekt/Nominativ– Verb Modal/wollen– NP Objekt/Akkusativ‘ korreliert.
Grundsätzlich geht der gebrauchsbasierte Ansatz davon aus, dass der langsame Auf- und Ausbau grammatischen Strukturwissens und die Musterfindung stets in den Kommunikationssituationen und bei den intendierten Bedeutungszusammenhängen ansetzt und dass in der Folge auch mental keine isolierte Grammatik repräsentiert ist, sondern dass die mentale Grammatik aufs Engste mit dem mentalen Lexikon verknüpft ist. Theoretisch modelliert wird dies im Rahmen der sogenannten KonstruktionsgrammatikKonstruktionsgrammatik.
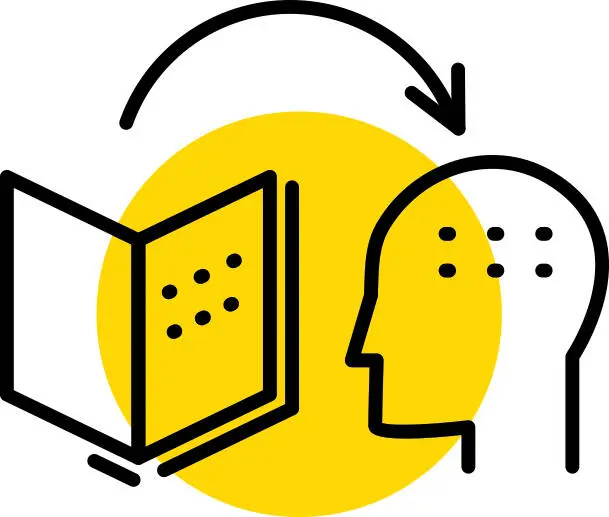 Konstruktionsgrammatik
Konstruktionsgrammatik
Den sprachtheoretischen Hintergrund von gebrauchsbasierten Spracherwerbstheorien bildet die Auffassung, dass in Bezug auf die mentale Repräsentation unserer Sprachfähigkeit die mentale Grammatik (der L1) aufs Engste mit dem mentalen Lexikon verknüpft ist. Modelliert wird dies als Konstruktionsgrammatik .
Konstruktionsgrammatiker:innen wie Lakoff (1987), Goldberg (1995, 2006) oder Croft (2001) gehen davon aus, dass sich die Struktur einer Sprache vollständig durch Form-Bedeutungspaare, sogenannte Konstruktionen , beschreiben lässt, beispielsweise:
| 1. |
Uhr / ‚Instrument zur Zeitmessung‘ |
| 2. |
V transitiv- bar → X ist V -bar / ‚X kann man V-en.‘ |
|
(z. B.: V = mach- → X ist machbar . / X kann man machen .) |
| 3. |
Form: [[NP Nom] [V] [NP Dat] [NP Akk]] / ‚Übertragung eines Besitzverhältnisses’ |
|
(z. B.: Die alte Dame gibt dem Gärtner einen Brief.) |
Die Beispiele illustrieren, dass sich der Konstruktionsbegriff auf alle linguistischen Beschreibungsebenen bezieht, so etwa in (1) die Ebene der Lexeme, die Ebene von Morphemverknüpfungen (Wortbildungsstruktur (2) und Flexionsstruktur), die Ebene der syntaktischen Struktur von Phrasen und Sätzen (3).
Konstruktionen sind auch kombinierbar: In dem Beispielsatz unter (3) manifestiert sich nicht nur eine Gesamtkonstruktion zur Übertragung eines Besitzverhältnisses; [ die alte Dame ] ist auch für sich betrachtet eine Nominalphrasenkonstruktion mit ‚Artikel – Adjektiv – Nomen‘ im Nominativ, die wiederum aus drei einfachen Konstruktionen bzw. Lexemen ( die, alte, Dame ) besteht.
In der Modellierung von kognitivem Sprachwissen in einer Konstruktionsgrammatik wird für das abstrakte grammatische Muster (das SchemaSchema) keine mentale Repräsentation unabhängig von der Abstraktionsbasis der lexikalischen Einheiten angenommen. Entsprechend geht der gebrauchsbasierte Spracherwerbsansatz davon aus, dass die Musterfindung und das Erkennen einer Konstruktion stets bei den konkreten Äußerungen auf Inhaltsebene beginnen.
Für die sich nur langsam entfaltenden AbstraktionsprozesseAbstraktionsprozesse ist ein erster Schritt wesentlich: Kinder erwerben komplexe sprachliche Ausdrücke und Konstruktionen ihrer L1 zunächst in Form von sprachlichen Gestalten ‒ d. h. in größeren, unanalysierten Einheiten, als Chun ks Chunks (siehe den nächsten Abschnitt, Kap. 3.3). Leitend ist der Inhalt, also die Bedeutung eines Chunks und wie man mit ihm in einer Kommunikationssituation agieren kann. Hypothesen über die Form der Konstruktion, d. h. über den Strukturaufbau und das zugrundeliegende grammatische Muster des Chunks, welches sich auch in anderen Ausdrücken findet und sich für die Bildung neuer Ausdrücke nutzen lässt – solche Generalisierungen werden erst nach Aneignung einer kritischen Massekritische Masse memorierter Ausdrücke unterschiedlicher Komplexität initiiert (vgl. Tomasello 2003, 2006).
Das bedeutet: Um ein Muster zu erkennen, braucht es eine Basis an zahlreichen gleichen, aber auch leicht variierenden Äußerungen. Dies macht die Art und Quantität des Inputs zu einer wesentlichen Größe im Erwerbsprozess.
Eine zentrale Frage, die sich in diesem Kontext stellt, ist, in welchem Verhältnis Wiederholung und Variation stehen müssen, damit der Erwerb optimal verläuft. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen Tokenfreque nz Tokenfrequenz (der Vorkommenshäufigkeit eines konkreten Elements) und Typefreque nz Typefrequenz (dem Vorkommen von verschiedenen Vertretern eines zugrunde liegenden Musters). Beide FrequenztypenFrequenztypen lassen sich auf allen sprachlichen Ebenen ermitteln (Bryant 2012a: 195): So gilt beispielsweise für die Domäne der dynamischen lokalen Verben, dass die Typefrequenz von Fortbewegungsverben ( gehen, fahren, kriechen, schleichen, schlendern, rennen, sprinten, fliegen, …) in den meisten Kontexten höher ist als die von kausativen Positionsverben ( setzen, stellen, legen, stecken, … ) . Und innerhalb der Fortbewegungsverben ist gehen der Vertreter mit der höchsten Tokenfrequenz. Wie ist der Input nun optimal anzureichern? Angenommen, das Erwerbsziel ist ‚Fortbewegungsverben + rein ‘. Ist es für den Erwerbsprozess günstiger, nur den Hauptrepräsentanten (als prototypischen Vertreter) der Fortbewegungsverben in hoher Tokenfrequenz anzubieten, vgl. (1), oder sollte man die Typefrequenz lancieren, vgl. (2), oder entspricht eine Kombination aus hoher Tokenfrequenz beim Prototypen und moderater Typefrequenz, (vgl. (3)), dem optimalen Input?
Читать дальше
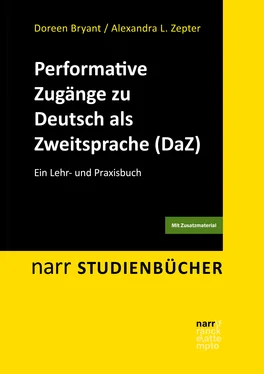
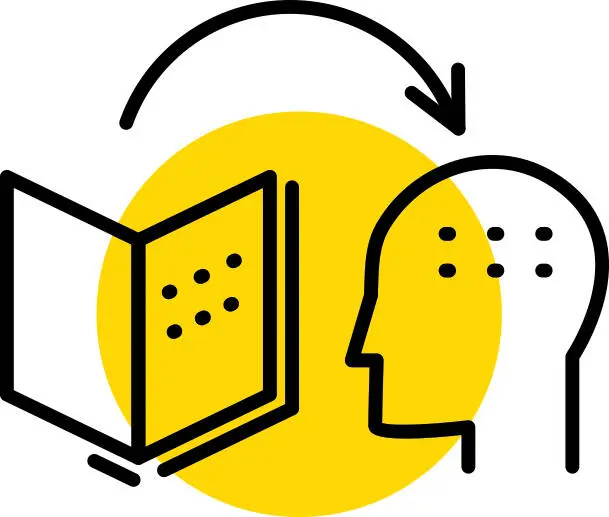 Konstruktionsgrammatik
Konstruktionsgrammatik