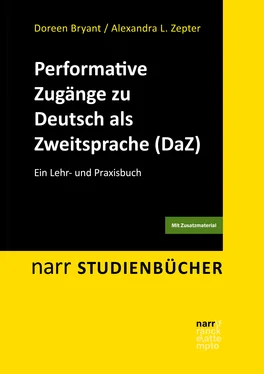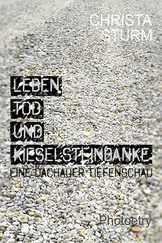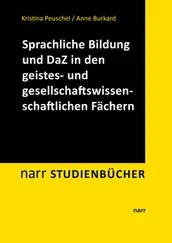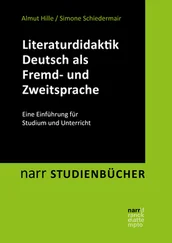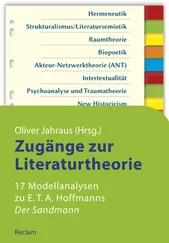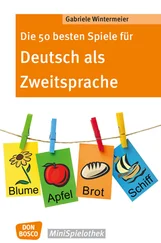| (1) |
reingehen, reingehen, reingehen, reingehen, reingehen, reingehen, reingehen, reingehen |
| (2) |
reingehen, reinlaufen, reinrennen, reinfahren, reinschleichen, reinspringen, reinstolpern, reinstürzen |
| (3) |
reingehen, reingehen, reingehen, reingehen, |
|
reinlaufen, reinfahren, reinschleichen, reinspringen |
Casenhiser & Goldberg (2005) haben (anhand anderer Konstruktionen einer zu lernenden Kunstsprache) gezeigt, dass (3) das ideale Angebot für die Lernenden darstellt. Warum?
Eine hohe Tokenfrequenz führt zur Verankerung/Einschleifung, indem sie starke Gedächtnisspuren hinterlässt, während die Variation der Types zur Abstraktion führt. (Tomasello 2003, zitiert in Behrens 2009: 399; eigene Übersetzung)
Durch die hohe Tokenfrequenz wird eine solide Ankerstruktur gelegt, die Wiedererkennen ermöglicht. Durch die Typefrequenz wird die Analogiebildung und Musterfindung angeregt. Mangelt es in sensiblen Erwerbsphasen an Types, kommt es zur FossilisierungFossilisierung der AnkerstrukturAnkerstruktur. Dieser Effekt zeigt sich beispielsweise bei einigen DaZ-Lernenden, wenn sie als einziges Fortbewegungsverb gehen verwenden oder bei statischer Lokalisierung nur sein gebrauchen. Dem ist mit rechtzeitiger TypevarianzTypevarianz beizukommen (Bryant 2012a: 195).
Laut Casenhiser & Goldberg (2005) entspricht das Token-/Type-Frequenzmuster 4+/1-1-1-1 von (3) in etwa dem elterlichen Input, und zwar sprachübergreifend (u.a. Cameron-Faulkner et al. 2003). Ein solches Muster, bei dem ein Type oder einige wenige Types in hoher Tokenfrequenz vorkommen, während die anderen Types in deutlich niedrigerer Frequenz auftreten, nennt man aufgrund der ungleichen Verteilung skewed (‚schief‘, ‚verzerrt‘). Diese Art von Input gilt als typisch für die kindgerichtete Sprache im L1-Erwerb und wird auch als begünstigend im L2-Erwerb erachtet (u.a. Bybee 2008).
Die empirische Evidenz für den gesteuerten L2-Erwerb ist jedoch widersprüchlich (siehe Madlener 2015, 2016). In ihrer eigenen Unterrichtsstudie, die Madlener mit erwachsenen Deutschlernenden auf B2-Sprachniveau unter verschiedenen Inputbedingungen durchgeführt hat, konnten die Lernenden nicht vom ‚schiefen‘ Frequenzmuster profitieren, aber von einer niedrigen Typefrequenz bei hoher Tokenfrequenz eines jeden Types. Daraus ableitend, empfiehlt Madlener, dass Sprachlehrbücher die Typefrequenz am Anfang des Aneignungsprozesses eines Musters eher sparsam dosieren sollten:
Zukünftige Lehrwerke für Deutsch als Zweitsprache sollten daher grundsätzlich Inputfluten bereitstellen, um die Chancen für beiläufiges Grammatiklernen konsequent zu erhöhen. Darüber hinaus zeigt unsere Studie, dass der Erfolg des beiläufigen Grammatiklernens aus Inputfluten mit geringerer lexikalischer Dichte (d. h. reduzierter Typefrequenz) zunimmt. Dies deutet darauf hin, dass man den Lernenden die Möglichkeit geben sollte, neue Muster im Input mit niedriger Typefrequenz zu erkennen, bevor sie dazu gedrängt werden, eine größere Vielfalt an lexikalischen Konkretisierungen für die Zielkonstruktion zu entdecken. Es sollte daher vermieden werden, dass die Lernenden gleichzeitig mit dem Erwerb eines neuen Musters auch neues Vokabular lernen, da dies zu einer kognitiven Überlastung führt. Daher sollte bei erstem Kontakt mit einer neuen Konstruktion bezogen auf die Typefrequenz ein ‚Weniger ist mehr‘-Ansatz verfolgt werden. (Madlener 2016: 167; eigene Übersetzung)
Insgesamt lässt sich aus der Perspektive des gebrauchsbasierten Spracherwerbsansatzes resümieren, dass der Input sowohl in seiner Quantität als auch Qualität von wesentlicher Bedeutung für den Erwerbsprozess ist. Auch bei Zweitsprachenlernenden wird die Aneignung von Mustern begünstigt, wenn die Typefrequenz zunächst moderat dosiert wird. Erst später (nach Mustererkennung) ist die Typefrequenz zu erhöhen, um einen produktiven Gebrauch des Musters anzustoßen. Die Grundlage aber für Mustererkennung liefern Chunks, mit denen sich nun das folgende Teilkapitel befasst.
3.3 Zur Rolle von Chunks beim Sprachgebrauch und im Spracherwerb (L1 und L2)1
Das englische Wort Chu nk Chunks bedeutet ins Deutsche übersetzt ‚Brocken‘, ‚großes Stück‘, ‚Klumpen‘, ‚Klotz‘ oder ‚Segment‘. In der Sprachtheorie bezeichnet man als Chunks sprachliche Sequenzen von unterschiedlicher Komplexität, die als Ganzes gespeichert und abgerufen werden. Als holistische Einheitholistische Einheit belasten sie das ArbeitsgedächtnisArbeitsgedächtnis weniger als die Komposition ihrer einzelnen Bestandteile (vgl. Miller 1956). L1-Sprecher:innen machen regen Gebrauch von Chunks und erreichen so eine enorme Geschwindigkeit in der Sprachverarbeitung (u.a. Pawley & Syder 1983) – sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption (Aguado 2014).
Auch die Sprache von L2-Lernenden gewinnt mit dem Gebrauch von Chunks an Flüssigkeit und Natürlichkeit (Stengers et al. 2011). L2-Lernende, die sich geschickt mit situationsangemessenen Chunks zu verständigen wissen, wähnt man schnell auf einem hohen Sprachniveau und ist überrascht, wenn Folgeäußerungen dem nicht mehr entsprechen. Für Lehrkräfte ist es oft nicht leicht zu entscheiden, ob die/der Lernende eine Struktur als memorisierte Sequenz oder unter Anwendung der Regel eigenständig produziert.
Das „ChunkingChunking“ sollte dabei nicht negativ bewertet werden, es handelt sich um eine zu unterstützende Erwerbs- bzw. Lernstrategie (u.a. Handwerker 2008). Über ein umfangreiches Chunk-Repertoire zu verfügen, ist schließlich nicht nur für den Sprachgebrauch, sondern auch für den Grammatikerwerb von Vorteil, denn es kann als Induktionsbasis für das Erschließen von Regelhaftigkeiten der Zielsprache zur Verfügung stehen.
Im L1-Erwerb gebrauchen Kinder zunächst unanalysierte Einheiten und generieren sukzessive aus der Chunk-Basis über verschiedene Abstraktionsstufen die zugrundeliegenden Konstruktionen (u.a. Tomasello 2006; siehe oben, Kap. 3.2).
Auch im kindlichen L2-Erwerb gibt es Hinweise darauf, dass Sequenzen aus dem zielsprachlichen Input als Chunks gespeichert werden, die dann als Basis für spätere Analyseprozesse dienen (u.a. Wong Fillmore 1976). Jugendliche und erwachsene L2-Lernende verwenden zwar ebenfalls Chunks, scheinen diese aber weniger nutzen zu können, um daraus Regelhaftigkeiten zu extrahieren (Aguado 2014). Ältere Lernende achten offenbar mehr auf einzelne Wörter und weniger auf Wortsequenzen und Syntagmen (Handwerker & Madlener 2009). Möglicherweise ist dies eine Folge des im Fremdsprachenunterricht immer noch praktizierten Vokabellernens (Aguado 2014).
Alle L2-Lernenden sollten darin unterstützt werden, die Potenziale des Chunkings für den Sprachgebrauch und vor allem auch für den Grammatikerwerb zu nutzen. Beispielsweise wird mit einem vorstrukturierten Input, der in verständlichen situativen Kontexten wiederkehrend gleiche und leicht modifizierte Chunks anbietet, zunächst erreicht, dass die Lernenden die Chunks situativ angemessen und korrekt gebrauchen, ohne sich deren atomarer Bestandteile bewusst zu sein. Grammatikerwerb beginnt dann, wenn die Lernenden im Input ähnliche Chunks identifizieren, wie etwa mit dem Stift , mit der Schere , mit dem Lineal , und am Artikel Gleiches und Unterschiedliches bemerken (Bischoff & Bryant 2020). Das Entdecken von Regelhaftigkeiten kann z. B. durch Markierungen oder auch gezieltes Fragen beschleunigt werden. Der vorstrukturierte Input mit ähnlichen Chunks hilft (den jüngeren Lernenden besser als den älteren), Muster und zugrundeliegende Konstruktionen zu erkennen. Bei Schüler:innen und Erwachsenen sollte dieser Prozess explizit (metasprachlich) unterstützt werden (Handwerker & Madlener 2009).
Читать дальше