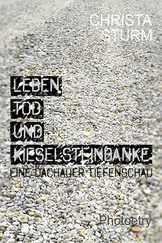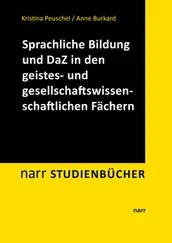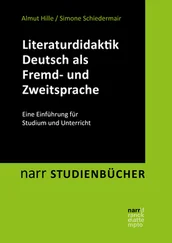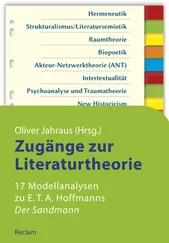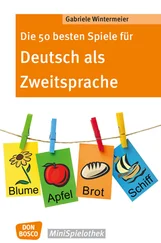| (2) |
K: |
Der hat da rein getut. |
|
E1: |
Rein getan. |
|
E2: |
Der hat etwas da rein getan. |
|
E3: |
Der Junge hat die Äpfel in den Korb getan. |
Um Kinder zur eigenen Sprachproduktion zu motivieren, nutzen die erwachsenen Bezugspersonen unterschiedliche Fragetypen, wobei mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Entscheidungsfragen ein nur geringes Anregungspotenzial besitzen – im Kontrast zu Fragen, die eine mehr Informationen enthaltende Antwort verlangen. Als besonders animierend gilt auch die Strategie der Widerspruchsprovokation. Hierbei benennt die/der Erwachsene einen Gegenstand falsch oder beschreibt einen Sachverhalt inkorrekt, um das Kind aus der Reserve zu locken. Anregend und förderlich für den Ausbau des sprachlichen Repertoires erweist sich zudem eine Gesprächsführung, bei der man gemeinsam möglichst lange an einem Thema bleibt (= vertikale Dialogstruktur) und das Kind somit einen inhaltlich wie auch strukturell differenzierten Input erhält.
(nach Ritterfeld 2000: 408–420)
Der an Zweitsprachenerwerbende gerichtete Input ist für gewöhnlich weniger angepasst. Wenn der Input in Qualität und Quantität nicht ausreichend ist, um Interimshypothesen über die Zielsprache oder Behelfslösungen über Bord zu werfen und es keine korrigierende Instanz gibt, besteht im ungesteuerten Zweitsprachenerwerb die Gefahr, dass sich nicht-zielsprachliche Konstruktionen verfestigen. Auch kann es sein, dass komplexe Strukturen nicht in Angriff genommen werden, weil sie nicht ausreichend im Input enthalten sind und/oder nicht eingefordert werden.
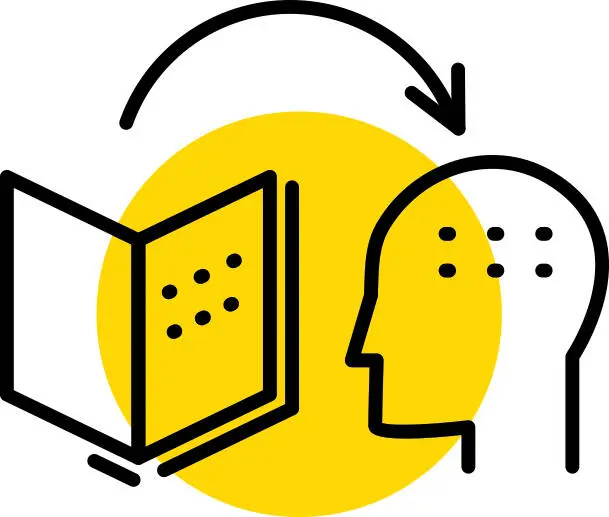 Interimsgrammat ikInterimsgrammatik , Interimshypothe seInterimshypothese
Interimsgrammat ikInterimsgrammatik , Interimshypothe seInterimshypothese
Auf dem Weg in die Zielsprache konstruiert die/der Lernende auf der Basis bisheriger L2-Erfahrungen (und anderer Faktoren wie z. B. Einflüsse der L1) ein individuelles Sprachsystem, das sich zunehmend der Zielsprache annähert. Man spricht auch von Interlangua ge Interlanguage (Selinker 1972) oder Interimsgrammatik. Die Annahmen, die der/die Lernende hierbei über die Zielsprache trifft, nennt man Interimshypothesen.
Um ein Beispiel für eine typische Interimshypothese von Deutschlernenden im späten kindlichen oder im erwachsenen L2-Erwerb zu nennen: Aufgrund der Struktur in einfachen deutschen Hauptsätzen ( Ich mag Pizza , Wir gehen ins Kino ), die im Input sehr häufig enthalten sind, bilden viele Lernende die Interimshypothese, dass im Deutschen immer die Abfolge ‚Subjekt – Prädikat‘ gilt. Entspricht diese angenommene Abfolge zudem der L1-Wortstellung (z. B. Russisch, Englisch, Spanisch) erfährt die Interimshypothese zusätzliche Unterstützung. Diese Hypothese führt allerdings zu zielsprachlichen Abweichungen, wenn beispielsweise ein Temporaladverbial den Satzanfang bildet (* Morgen wir gehen ins Kino ) und muss revidiert werden.
Die Lernenden benötigen einen Input, der hinreichend Evidenz liefert, dass das Deutsche eine Verbzweit-Sprache ist und vor dem finiten Verb nur eine Konstituente stehen darf. Um die Lernenden zur zielsprachlichen Hypothese zu führen, benötigen sie viele Sätze vom Typ: Morgen gehen wir ins Kino .
Die primäre Zielgruppe der methodischen Ansätze dieses Buches sind Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) – also Deutschlernende, die in einem deutschsprachigen Land leben. Unter ihnen sind Deutschlernende:
1 deren Erwerb nahezu ohne Steuerung verlief,
2 deren ungesteuerter ErwerbErwerbungesteuert in der Kita und/oder in der Schule durch verschiedene Angebote zusätzlich unterstützt wurde,
3 deren Einstieg in die deutsche Sprache (z. B. in einer Vorbereitungsklasse) gesteuert (wie im Fremdsprachenunterricht) verlief – mehr oder weniger flankiert durch Gelegenheiten des natürlichen Sprachkontakts mit L1-Sprecher:innen.
Der Erstsprachenerwerb gilt im Allgemeinen als sehr robust und sein Erfolg (so keine Sprachstörungen oder besondere Förderbedarfe vorliegen) bezogen auf das Beherrschen der basalen Grammatik als garantiert. Er verläuft unabhängig von Intelligenz und unabhängig von der Modalität (ob nun Laut- oder Gebärdensprache) recht systematisch und mit beeindruckender Geschwindigkeit. Die Kinder durchlaufen unabhängig von der Zielsprache bestimmte Entwicklungsstufen und benötigen keine explizite Instruktion. Das erstsprachliche Wissen ist überwiegend implizit, dem Bewusstsein nicht ohne Weiteres zugänglich. Kerngrammatische Bereiche wie etwa die Wortstellungsregularitäten gelten im Alter von vier Jahren als erworben (u.a. Kauschke 2012: 93).1
Ein deutlich heterogeneres Bild begegnet uns beim Zweitsprachenerwerb, und zwar in Bezug auf die Dauer, den Verlauf und das Erreichen eines bestimmten Sprachniveaus. Dass es Unterschiede zwischen L1- und L2-Erwerb gibt, ist unstrittig (Meisel 2007: 99), denn ein gleiches Ziel kann von unterschiedlichen Ausgangspunkten nicht auf gleichem Wege erreicht werden (ebd.: 99). Während L1-Lernende bei Null starten, verfügen L2-Lernende bereits über ein zumindest teilweise ausgebildetes Sprachsystem (mit möglicherweise verursachenden Interferenzen); über weiter entwickelte kognitive Fähigkeiten, die andere Sprachverarbeitungsoptionen eröffnen; über konkrete kommunikative Bedürfnisse und Handlungsroutinen sowie über Welterfahrungen. Daher sind Äußerungen zu Beginn des L2-Erwerbs in der Regel länger und komplexer als frühe L1-Äußerungen (ebd.: 99).
Trotz des vielversprechenden Auftakts, erreichen viele L2-Lernende nicht das Sprachniveau, das sie anstreben.
Welche Faktoren in welcher Gewichtung welchen Einfluss auf die L2-Entwicklung haben, beschäftigt die Forschung anhaltend. Aufgrund des komplexen Zusammenspiels zahlreicher Faktoren (z. B. Alter zu Erwerbsbeginn, Dauer des Sprachkontakts, Intensität des Kontakts, sozioökonomischer Hintergrund, Sprachlernbegabung, Sprachlernerfahrungen, Motivation, Einstellung zur Zielsprache – um hier nur einige zu nennen) ist jedes MehrsprachigkeitsprofilMehrsprachigkeitsprofil einzigartig (Bryant & Rinker 2021: 22). Die oben skizzierten Erwerbsszenarien geben lediglich eine erste Orientierung und erlauben keine verlässlichen Aussagen über den Erfolg des Zweitsprachenerwerbs (ebd.: 16). Bei allen noch ungeklärten Forschungsfragen zum wechselseitigen Wirken innerer und äußerer Faktoren, herrscht aber doch Einigkeit darüber, dass die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten maßgeblich von der QuantitätInputQuantität und Qualität des InputsInputQualität abhängen (Bryant & Rinker 2021: 19–23).
Input gehört zu den äußeren erwerbsbeeinflussenden Faktoren, die von Seiten der Lehrkraft entscheidend mitbestimmt werden – im Fremdsprachenerwerb noch mehr als im Zweitsprachenerwerb, da bei Letzterem auch außerhalb des Unterrichts sprachanregende Begegnungen (u.a.) mit Gleichaltrigen im schulischen und außerschulischen Bereich stattfinden. Die Chance eines DaZ-Unterrichts besteht neben der Unterstützung des Sprachauf- und -ausbaus auch in der Korrektur von im ungesteuerten Erwerbsprozess eingeschliffenen nicht-zielsprachlichen Konstruktionen. Ein strukturfokussiertes Vorgehen ist hierbei unerlässlich (siehe Kap. 3.6).
3.2 Gebrauchsbasierte ( usage-based ) Spracherwerbskonzeption
Eine der entscheidenden Fragen in der Spracherwerbstheorie betrifft die Rolle des Inputs. Diesbezüglich gibt es zwei grundlegend verschiedene Auffassungen: Der nativistischen Annahme zufolge ist der Mensch für den Erwerb der Sprache prädisponiert, d. h. ein erheblicher Teil des impliziten Sprachstrukturwissens ist über das genetische Erbgut vermittelt und somit angeboren (u.a. Chomsky 1981; erinnere Kap. 1.2, zur Sprachkompetenz). Dem Input kommt in diesem Fall lediglich eine Triggerfunktion zu, um das bei Geburt bereits vorhandene grammatische Regel-/Strukturwissen sprachspezifisch auszudifferenzieren. Mit der nativistischen Position verknüpft ist zudem die Auffassung, dass Sprache mental separat repräsentiert und (weitgehend) unabhängig von Wahrnehmung (und Motorik) verarbeitet wird (siehe Kap. 2.2).
Читать дальше
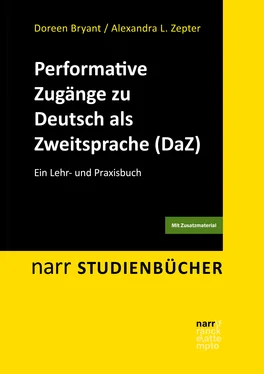
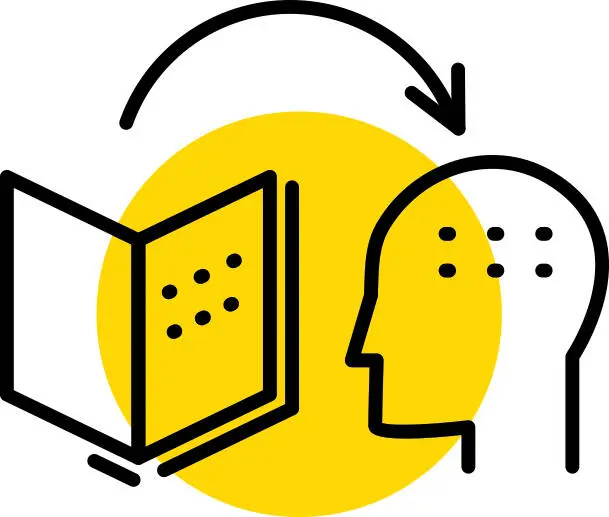 Interimsgrammat ikInterimsgrammatik , Interimshypothe seInterimshypothese
Interimsgrammat ikInterimsgrammatik , Interimshypothe seInterimshypothese