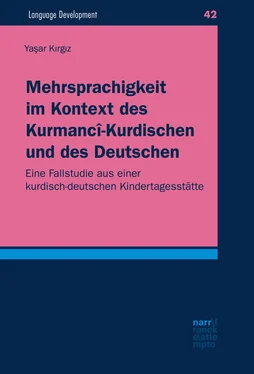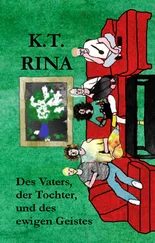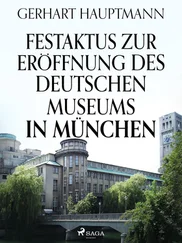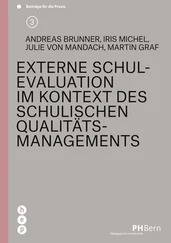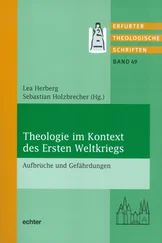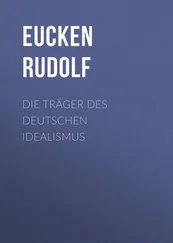Entlang der Tempusformen erfolgt auch die Unterscheidung zwischen Ergativ-Sätzen und nicht-Ergativ-Sätzen. Denn die Ergativstrukturen kommen nur bei jenen Tempusformen zustande, die auf der Grundlage des Präteritalstamms gebildet werden (vgl. Bedir Khan/Lescot 1986: 151), so dass sie als gespaltene Ergativität definiert werden können (vgl. Schroeder 2002: 192, für weitere Informationen hinsichtlich der Ergativität in Kurmancî siehe Tan 2005). Aber auch in den Zeitformen, in denen Ergativität vorkommt, gibt es Abweichungen, die in der Erörterung der Syntax thematisiert werden.
In Kurmancî sind die morphologischen Kategorien für die Syntax von Bedeutung. Hier kann in erster Linie die Kongruenz erwähnt werden. Im Konkreten: Die Person und der Numerus stellen die Kongruenz zwischen dem Verb und dem Subjekt oder dem direkten Objekt her. Ebenso ist das Genus in Kurmancî für die pronominale Referenz von Relevanz, falls es markiert wird.
In Bezug auf die Ergativität wurde bereits festgehalten, dass sie zum einen gespalten ist und dass es zum anderen auch in den Fällen, in denen eine Ergativstruktur vorhanden sein soll, Abweichungen geben kann. Diese können sowohl die Markierung des Subjekts und des Objekts1 als auch die Kongruenz mit dem Verb betreffen (vgl. Dorleijn 1996, Gündoğdu 2017, Haig/Öpengin 2018, Mahalingappa 2009, Turgut 2011).
Anders als im Deutschen beansprucht das Verb in Kurmancî in der Regel die Endstelle. Falls der Satz über ein Modalverb wie xwestin „wollen, mögen“ verfügt, kommt dieses nach dem Subjekt und vor dem Objekt2. Das Hauptverb beansprucht wiederum die Endstelle. Lediglich Richtungsadverbiale sowie indirekte Objekte ohne Adpositionen werden postprädikativ gesetzt (vgl. Boeder/Schroeder 1998: 211, Haig 2002: 20). Hier kann also im Gegensatz zum Deutschen nicht entlang der Verbstellung ein Richtungsweg des Spracherwerbs gezeichnet werden. Dennoch müsste, da das Verb auch in Kurmancî das organisierende Zentrum des Satzes ist, sein Erwerb für die Sprachentwicklung des Kurmancî von Bedeutung sein (vgl. Reich/Roth 2004b: 6). Darüber hinaus verfügt das Verb in Kurmancî über zwei Stämme, was zum einen für die Bildung der Tempusformen, zum anderen aber auch für die Formung der Ergativ- versus nicht-Ergativstrukturen von Bedeutung ist. Somit könnte also die Nutzung des Verbs als organisierendes Zentrum des Satzes in Kurmancî mit seinen verschiedenen Formen und Funktionen einen Eindruck vermitteln, inwiefern die Sprachkompetenz eines Kindes in Kurmancî entwickelt ist.
Zum Schluss ist zu unterstreichen, dass die grammatischen Kategorien der Nominalphrase in Kurmancî schwach oder in manchen Fällen gar nicht ausgedrückt werden, und wenn, dann nur anhand weniger sprachlicher Elemente. Dies führt auch dazu, dass die Nominalphrase in Kurmancî mit weniger Flexionen auskommt als in Sprachen wie dem Deutschen.
4.2 Forschungsgegenstand Deutsch1
4.2.1 Phonologie
Hinsichtlich der Phonologie ist zunächst festzuhalten, dass das Deutsche sich im Gegensatz zu Kurmancî durch komplexe Silben auszeichnet. Dies bedeutet, dass die meisten Silben von dem Muster Konsonant-Vokal (KV) abweichen, das eine einfache Silbenstruktur ausmacht, so wie sie in Sprachen wie Japanisch vorzufinden ist (vgl. Eisenberg 2013a: 133). Wörter wie Strumpf [ʃtʀʊmpf] oder Sprache [ʃpraːxə] sind einige Beispiele für die Silbenkomplexität des Deutschen (vgl. Jeuk 2003: 16). Die ersten Wortproduktionen der Kinder in Deutsch wie Mama und Papa folgen der einfachen Silbenstruktur und weichen damit von der komplexen Silbenstruktur ab (vgl. Kauschke 2012: 33, für einen Überblick zur Silbenkomplexität des Deutschen hinsichtlich seines Erwerbs siehe auch Lleó/Prinz 1996). Darüber hinaus scheinen Kinder weitgehend unabhängig von ihrer Sprache zunächst Wörter mit einfacher Silbenstruktur zu produzieren (vgl. Nübling 2010: 17).
In der Spracherwerbsforschung wird im Allgemeinen angenommen, dass Kinder die komplexe Silbenstruktur des Deutschen gut meistern, und zwar unabhängig davon, ob sie das Deutsche von Geburt an oder im Anschluss an eine andere Sprache bzw. andere Sprachen sukzessiv erwerben. Lediglich Schulz/Tracy erwähnen einen Fall, dass ein Kind, dessen Erstsprache keine Konsonantenverbindungen am Silbenrand erlaubt, ein Wort wie Sport als Soporata artikuliert (vgl. Schulz/Tracy 2011: 24). Ab welchem Alter und unter welchen Bedingungen dieses Kind das Deutsche erwirbt oder erworben hat, wird nicht ausgeführt. Bei Rothweiler/Ruberg gibt es den Hinweis, „dass Kinder mit türkischer Erstsprache im Erwerb des Deutschen solche Laute oder Lautkombinationen, die es im Türkischen nicht gibt, vorübergehend in einer Weise realisieren, wie es bei einsprachig deutschen Kindern nicht beobachtet wird.“1 (Rothweiler/Ruberg 2014: 257)
Weiterhin gilt das Deutsche als eine akzentzählende Sprache. In akzentzählenden Sprachen ist die Unterscheidung zwischen der betonten und unbetonten Silbe zentral und die temporale Aufeinanderfolge betonter Silben maßgeblich (vgl. Kaltenbacher 1998: 21).
Die Unterscheidung der Genera wird im Deutschen vom Nomen bestimmt, aber nicht am Nomen markiert (vgl. Kaltenbacher/Klages 2007: 85). Spätestens seit Wegener (1995) wird über die Unterscheidung der Genera die Diskussion geführt, ob sie – zumindest zu einem gewissen Anteil – regelgeleitet erfolgt. Wegener stellt fest, dass anhand von fünf Regeln bei 65,4% der Nomen des Grundwortschatzes des Deutschen vorhergesagt werden kann, welches Genus sie zugewiesen bekommen (vgl. Wegener 1995: 93). Eine der Regeln ist das natürliche Geschlechtsprinzip (NGP), während die anderen Regeln sich auf die formalen Eigenschaften der Nomen beziehen. Wenn beispielsweise ein Nomen des Grundwortschatzes auf Schwa -e endet, wird es mit 90,5% Wahrscheinlichkeit das feminine Genus haben, wie etwa die Hose , die Jacke , die Nase (vgl. Wegener 1995: 89ff.). Auch andere Arbeiten wie die von Köpcke/Zubin (1996) und Koeppel (2018) schließen sich diesem Ansatz an und versuchen, neue Regeln herauszuarbeiten, nach denen das Genus der Nomen vorausgesagt werden kann.
Neben der Tatsache, dass diese Regeln weder den gesamten Wortschatz noch auch nur den Grundwortschatz erfassen, wird von diesen Autor*innen selbst angemerkt, dass sie meistens ohne Ausnahmen nicht auskommen (vgl. Wegener 1995: 94). Dennoch sind vor allem Wegener (1995) und Koeppel (2018) der Meinung, dass sowohl beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache als auch beim Lernen des Deutschen als Fremdsprache diese Regeln in Anspruch genommen werden sollten. Damit soll dem Eindruck, dass die Zuweisung des Genus im Deutschen systemlos und völlig arbiträr sei, entgegengesteuert werden. „Der fälschliche Eindruck von Willkürlichkeit und Sinnlosigkeit des Genus ist nicht nur demotivierend, sondern kann dazu führen, dass in der Rezeption die vorhandenen sprachlichen Regularitäten im Input für den Erwerb nicht oder nicht optimal genutzt werden.“ (Koeppel 2018: 4)
Diese Sichtweise wird in der Spracherwerbsforschung aber nicht generell akzeptiert, bzw. einige Autor*innen vertreten die Ansicht, dass das Genus der Nomen in den meisten Fällen einzeln ohne Regularitäten erworben oder gelernt werden muss (vgl. Grimm/Schulz 2014: 37). Dies ist beispielsweise die Sichtweise von Schulz/Tracy, die den Erwerb oder das Lernen des Genus in der theoretischen Erläuterung des Instruments LiSe-DaZ als Domäne von „item-by-item-Lernen“ definieren (Schulz/Tracy 2011: 20).
Die Unterscheidung der Kasusformen in Kasussprachen wie Deutsch ist insofern von Bedeutung, als mit ihnen in der Regel syntaktische und semantische Rollen im Satz unterschieden werden. So bringt im Deutschen meistens der Nominativ das Subjekt, der Akkusativ das direkte Objekt und der Dativ das indirekte Objekt zum Ausdruck (vgl. Kauschke 2012: 77). Des Weiteren reguliert der Kasus innerhalb der Präpositionalphrase die Korrelation zwischen dem Kopf der Nominalphrase – dem Nomen – und der Präposition. Folglich wird der Kasus auf der Satzebene vom Verb, das die syntaktischen und semantischen Rollen festlegt, und in der Präpositionalphrase von der Präposition regiert (vgl. Marx 2014: 103).
Читать дальше