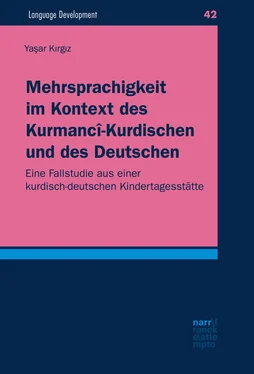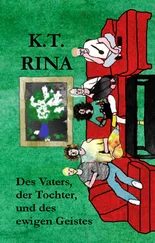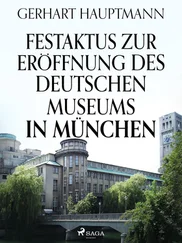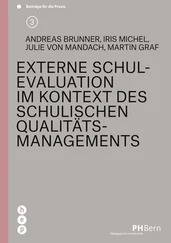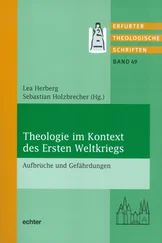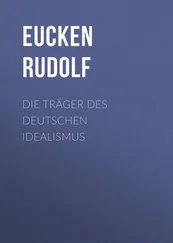In der autonomen Region Nordirak muss Kurmancî – in der Region eher Behdînanî (Badînî) genannt – sich allerdings gegenüber dem Soranî behaupten, das dort im Gegensatz zum Kurmancî verbreiteter und, damit einhergehend, die dominante Varietät des Kurdischen ist (vgl. Hassanpour/Sheyholislami/Skutnabb-Kangas 2012: 8, Thackston 2006: VII).
In Syrien war Kurmancî, das dort als die einzige Varietät des Kurdischen gesprochen wird, weder die Sprache der Öffentlichkeit noch der Bildung1. Es war bestenfalls die Sprache der Familie und des nahen Umfeldes. Die Situation änderte sich, als die Kurd*innen ab Mitte 2012 begannen, die Kontrolle in den vorwiegend von ihnen besiedelten Regionen zu übernehmen und sich autonom zu organisieren. Über einige Regionen haben sie aber inzwischen die Kontrolle verloren, wie z.B. über Afrin. In den Regionen, die sie weiterhin verwalten, versuchen sie Kurmancî in der Öffentlichkeit und in der Bildung zu etablieren. Die von ihnen verwalteten Regionen sind aber ständigen Gefahren, u.a. Invasionen, ausgesetzt. Zudem ist der Status der autonomen Verwaltung weder durch die aktuelle syrische Regierung noch durch die internationale Gemeinschaft anerkannt (vgl. Brizić/Grond 2017: 23).
Im Iran und in der Türkei ist die Situation der kurdischen Varietäten und damit auch des Kurmancî derzeit am ungünstigsten. Es ist anzumerken, dass von dieser Situation nicht nur die kurdischen Varietäten, sondern – bis auf die jeweilige Staatssprache Farsi bzw. Türkisch – auch alle anderen (Minderheiten-)Sprachen in diesen Ländern betroffen sind. Motiviert durch die Vorstellung „ein Staat, eine Nation, eine Sprache“ sind alle anderen Sprachen einer einzigen Sprache – dem Standard-Farsi im Iran und dem Standard-Türkisch in der Türkei – untergeordnet (vgl. Derince 2017: 177, Grond 2018: 36, Skubsch 2002: 259f.). Im Iran, wo die kurdischen Varietäten dem Farsi untergeordnet, aber zugleich mit ihm eng verwandt sind, wird diesen im öffentlichen Raum und Bildungswesen kein Platz eingeräumt. In Bezug auf das Bildungswesen stellt Sheyholislami die Situation folgendermaßen dar: „In fact there is no evidence that any of the minority languages such as Azerbaijani, Kurdish and Baluchi have been officially taught in any elementary or secondary public or private school that operates under the auspices of the Iranian Ministry of Education and Training.“ (Sheyholislami 2012: 35)
Die Türkei ist nicht nur das Land, in dem die meisten Kurmancîsprecher*innen leben, sondern sie ist auch das Land, in dem die meisten Kurd*innen insgesamt leben. Die Praktiken der Türkei gegen Kurdisch – gemeint sind hier die beiden Varietäten Kurmancî und Zazakî2 – seit ihrer Gründung (1923) bis zum Jahr 2002 waren dermaßen restriktiv, dass sie in der Gesamtheit manchen Forscher*innen zufolge einem „Linguizid“ gleichkamen (vgl. Zeydanlıoğlu 2012: 106). Die Restriktionen erreichten im Jahr 1983 ihren Höhepunkt, als die Anwendung des Kurdischen verboten wurde, ohne dabei im Verbotstext das Kurdische zu nennen (vgl. Coşkun/Derince/Uçarlar 2011: 36, Grond 2018: 53f.). Das Verbot der kurdischen Sprache wurde 1991 teilweise gelockert, doch zu einer tatsächlichen Verbesserung kam es erst im Jahr 2002.
Beginnend im Jahr 2002 brachte die Türkei im Zuge der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union und mit der Absicht, das Land zu liberalisieren, Reformen auf den Weg (vgl. Zeydanlıoğlu 2012: 114). Diese Reformen haben die Restriktionen gegen das Kurdische gelockert und gaben der Sprache zum ersten Mal die Möglichkeit, in den öffentlichen Bereich zu gelangen. Die Kommunen in den kurdischen Gebieten der Türkei nutzten beispielsweise in begrenztem Maße die Sprache bei ihren Dienstleistungen (vgl. Derince 2017: 188). Ebenfalls im Zuge dieser Reformen wurde an einigen Universitäten unter diversen Namen die kurdische Sprache und Literatur als ein Studiengang angeboten. Ein wesentlicher Beitrag hinsichtlich Bildung in der kurdischen Sprache wurde dadurch geleistet, dass zwischen 2013 und 2015 einige Grundschulen und Kindergärten als Pilotprojekte in Kurdisch eingerichtet wurden (vgl. Baysu/Agirdag 2019: 1087, Derince 2017: 190). Allerdings änderte die Türkei ab etwa Mitte 2015 ihre Politik gegenüber den Kurd*innen wiederum stark (vgl. Grond 2018: 59f.). Damit einhergehend wurden die kurdischen Schulen wieder geschlossen und fast alle Kommunen, die den Erhalt und die Entfaltung des Kurdischen förderten, unter Zwangsverwaltung gestellt. Letztere schlossen wiederum umgehend die kurdischen Kindergärten (vgl. Derince 2017: 190f.). Auch andere Vereine und Institutionen wie Kurdî-Der oder das Kurdische Institut Istanbul, die vor allem in der Vermittlung des Kurdischen an Erwachsene tätig waren, wurden geschlossen. Die Schließung des Kurdischen Instituts Istanbul zeigt das Ausmaß der neuen Repressionen, das zum Teil die Zeit vor dem Jahr 2002 weit übertrifft. Denn das Kurdische Institut Istanbul wurde 1992 gegründet und hatte die vorherigen Repressionen überlebt (vgl. Evrensel 2016). Gegenwärtig sind in der Türkei die meisten Vereine, Institutionen, Fernsehsender etc., die in irgendeiner Weise das Kurdische fördern, geschlossen worden, es sei denn, sie sind vom Staat selbst eingesetzt und agieren in seinem Sinne. Es gibt aber jenseits des Staates immer wieder Bemühungen, Strukturen sowie Möglichkeiten zur Förderung des Kurdischen zu schaffen.
Es gab und gibt zahlreiche Kooperationsvorhaben zwischen Bildungseinrichtungen in Deutschland und der Türkei. Insbesondere die Berliner Kita Pîya bemühte sich darum, mit den kurdischsprachigen Kindergärten in der Türkei zu kooperieren, um Erfahrungen auszutauschen, Material zu akquirieren und Weiterbildungsmöglichkeiten hinsichtlich der Erweiterung der Kurmancî-Kompetenzen ihrer Erzieher*innen zu schaffen. Die geplante Kooperation kam jedoch unter den oben beschriebenen sprachpolitischen Bedingungen nicht zustande.
4.1.3 Kurmancî in der westeuropäischen Diaspora, in Deutschland und in Berlin
Auch wenn die Anfänge der kurdischen Diaspora in die westeuropäischen Staaten bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreichen, kam es zu einer zahlenmäßig bedeutsamen kurdischen Emigration erst ab den 1960er Jahren (vgl. Hassanpour/Mojab 2005: 217f.). In diesem Jahrzehnt erlebten die westeuropäischen Staaten, vor allem Deutschland, eine rasante wirtschaftliche Entwicklung. Die benötigten Arbeitskräfte wurden u.a. aus der Türkei durch Gastarbeiterverträge rekrutiert (vgl. Ammann 2019: 34). Unter diesen Gastarbeiter*innen waren auch Kurd*innen (vgl. Karataş 2019: 26). Die Migration der Kurd*innen in die westeuropäischen Staaten hielt auch in den siebziger und achtziger Jahren an, hatte aber immer mehr die Flucht als Ursache. Zum einen hatten im Jahr 1975 die Kurd*innen im Irak den Krieg um die Autonomiebestrebungen gegen die zentrale Regierung verloren, die während des Krieges und danach brutal gegen Kurd*innen vorging. Zum anderen fand im Jahr 1979 ein Regimewechsel im Iran statt und in der Türkei erfolgte 1980 ein Militärputsch. Beide Entwicklungen waren zu Ungunsten der Kurd*innen, und die Repressionen ihnen gegenüber nahmen zu, insbesondere auch sprachlich.
Im Jahr 1991 wurde im Irak in einem Teil der Gebiete, in denen Kurd*innen leben, auf Initiative der US-Regierung eine Sicherheitszone geschaffen. Die kurdische Migration aus dem Irak in westeuropäische Staaten ging aber weiter, da die politische Unsicherheit und mangelnde wirtschaftliche Entwicklung bestehen blieben (vgl. Ghaderi 2014: 137, Hassanpour/Mojab 2005: 218). Die neunziger Jahre waren jedoch geprägt durch die Fluchtmigration der Kurd*innen aus der Türkei. Das Hauptzielland der geflüchteten Kurd*innen war dabei Deutschland. In den Jahren zwischen 1991 und 2001 sollen etwa 197.250 Asylbewerber*innen aus der Türkei nach Deutschland gekommen sein. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Teil davon Kurd*innen waren (vgl. Engin 2019: 12).
Читать дальше