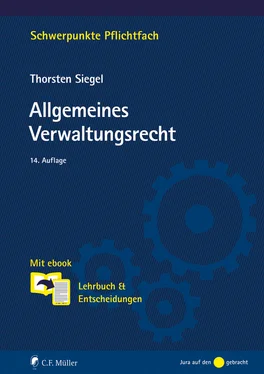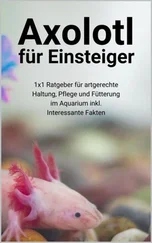3. Verfahren über eine einheitliche Stelle (§§ 71a ff VwVfG)
178
Im VwVfG zwischen dem förmlichen Verfahren und dem Planfeststellungsverfahren angesiedelt ist das Verfahren über eine einheitliche Stelle nach §§ 71a ff. Es verdankt diesen Standort allerdings nicht einer inhaltlichen Nähe zu den beiden es umschließenden Verfahrensarten, sondern dem Zufall, dass die zuvor in §§ 71a ff VwVfG a.F. enthaltenen Vorschriften zur Genehmigungsverfahrensbeschleunigung 2009 aufgehoben worden sind[12]. Die Einführung des Verfahrens über eine einheitliche Stelle beruht auf den Vorgaben der europäischen Dienstleistungsrichtlinie. Die einheitliche Stelle hat die Funktion eines Verfahrenskoordinators für Dienstleister. Bereits der Zusatz „über“ verdeutlicht, dass die Zuständigkeit der für die jeweiligen Verfahren verantwortlichen Behörden unberührt bleibt[13]. Das Verfahren über die einheitliche Stelle muss gemäß § 71a ebenfalls spezialgesetzlich angeordnet werden[14]. Ein entsprechender Anwendungsbefehl findet sich etwa in § 6b GewO[15].
4. Rechtsbehelfsverfahren (§§ 79 f VwVfG)
179
Ausdrücklich geregelt sind schließlich die Rechtsbehelfsverfahren gegen Verwaltungsakte in §§ 79 f VwVfG. Allerdings verweist § 79, 1. Hs. VwVfG für diese Verfahren grundsätzlich auf die VwGOweiter und erklärt das VwVfG lediglich im Übrigen für anwendbar. Darin kommt zugleich die Doppelfunktionder Rechtsbehelfsverfahren zum Ausdruck: Sie sind einerseits Verwaltungsverfahren i.S.d. VwVfG, andererseits aber auch Sachentscheidungsvoraussetzung für eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung. Es muss daher bis zur Entscheidung des Gerichts durchgeführt worden sein[16]. Wegen des letztlich verwaltungsprozessualen Schwerpunkts der Rechtsbehelfsverfahren werden sie deshalb üblicherweise in den Lehrbüchern zum Verwaltungsprozessrecht behandelt[17].
Ausbildungsliteratur:
Leist/Tams, Einführung in das Planfeststellungsrecht, JuS 2007, 1093; Pünder, Grundlagen des Verwaltungsverfahrensrechts, JuS 2011, 289; Siegel, Elektronisches Verwaltungshandeln, JURA 2020, 920.
§ 7 Handlungsmaßstäbe der Verwaltung
180
Bei ihrer Tätigkeit muss die öffentliche Verwaltung bestimmte Handlungsmaßstäbe einhalten. Diese sind typischerweise verfassungsrechtlich verankert. Da sie deshalb bereits in den Vorlesungen zum Verfassungsrecht behandelt worden sind, ist die nachfolgende Darstellung auf eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte dieser Maßstäbe beschränkt. Einen besonders wichtigen Handlungsmaßstab bildet der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung: Nach Art. 20 Abs. 3 GG ist die Verwaltung an Gesetz und Recht gebunden. Diese Aussage der Verfassung lässt sich in zwei für die Verwaltung relevante Aussagen ausdifferenzieren, zum einen in die Aussage vom Vorrangdes Gesetzes, zum anderen in die Aussage vom Vorbehaltdes Gesetzes (dazu u. II.). Darüber hinaus ist die öffentliche Verwaltung gemäß Art. 1 Abs. 3 GG an die Grundrechtegebunden (zur Frage einer etwaigen Lockerung dieser Bindung bei privatrechtlichem Handeln der Verwaltung s.u. Rn 877f). Eine spezifische Folge dieser Grundrechtsbindung ist die Pflicht zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (dazu u. III.). Weitere besonders bedeutsame Handlungsmaßstäbe bilden der allgemeine Gleichheitssatznach Art. 3 Abs. 1 GG (dazu u. IV.) sowie der Grundsatz des Vertrauensschutzes(dazu u. V.).
II. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
181
Der Vorrang des Gesetzes verbietet der Verwaltung, gegen ein Gesetz zu verstoßen. Er begründet damit ein Abweichungsverbot („kein Handeln gegen das Gesetz“[1] ). Auch wenn oftmals formelle Gesetze im Mittelpunkt des Gesetzesvorrangs stehen, erstreckt er sich auf die gesamte Rechtsordnung[2]. Der Vorrang des Gesetzes findet seine konsequente Fortentwicklung in der Prüfung der Vereinbarkeit einer Rechtsnorm mit höherrangigem Recht, insbes. eines formellen Gesetzes mit der Verfassung sowie von Rechtsverordnungen und Satzungen mit einfachen Gesetzen (hierzu sowie zur sich anschließenden Frage der Verwerfungskompetenz s.o. Rn 93ff).
182
Wird der Grundsatz nicht beachtet und verstößt eine Verwaltungsmaßnahme gegen das Gesetz, so stellt sich die Anschlussfrage der Fehlerfolge. Hier sind drei Grundkategorien zu unterscheiden. Die intensivste Fehlerfolge wäre die Nichtigkeitder Maßnahme. Diese wäre dann unwirksam und müsste grundsätzlich nicht beseitigt werden. Eine im Verwaltungsrecht verbreitete Fehlerfolge ist die schlichte Rechtswidrigkeit. Die Maßnahme bleibt wirksam, ist jedoch rechtswidrig und muss beseitigt werden, damit sie ihre Wirksamkeit verliert. Schließlich kann ein Verstoß auch unbeachtlich sein. Die Unbeachtlichkeitkann hier bei besonders geringfügigen Verstößen von vornherein bestehen, sie kann aber auch durch Fristablauf oder durch die Heilung des Fehlers nachträglich eintreten. Diese drei Grundkategorien kommen bei den einzelnen Handlungsformen in unterschiedlicher Weise zur Anwendung und werden deshalb dort genauer behandelt (so etwa beim Verwaltungsakt in Rn 571ff).
2. Vorbehalt des Gesetzes
183
Der Vorbehalt des Gesetzes gibt eine Antwort auf die Frage, ob für eine bestimmte Verwaltungstätigkeit eine Ermächtigungsgrundlagein einem förmlichen Gesetz erforderlich ist[3]. Ist dies der Fall, so darf die Verwaltung nicht ohne eine solche handeln ( „kein Handeln ohne Gesetz“[4]). Praktisch geht es beim Vorbehalt des Gesetzes um die Frage, wie weit das Parlament durch seine Gesetzgebung Verwaltungshandeln steuern muss. Allgemein anerkannt ist, dass jedes belastende Verwaltungshandeln, also jeder Eingriff in Freiheit und Eigentum des Bürgers, einer Ermächtigungsgrundlage in Form einer materiellen Norm (nicht unbedingt eines Parlamentsgesetzes) bedarf.
Beispiele:
| • |
Anordnungen zum äußeren Erscheinungsbild bei der Bundeswehr („Haar- und Barterlass“)[5], |
| • |
Nachverfolgung personenbezogener Daten wegen Corona-Verdachts[6]. |
Streitbefangen ist immer noch die Antwort auf die Frage, ob die Leistungsverwaltung, also zB die Subventionsgewährung, eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage benötigt. Die hM lehnt hier das Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage ab. Die Verwaltung soll schon dann handeln dürfen, wenn der Haushaltsplan die zu verteilenden Mittel ausweist[7]. Jenseits dieser Konstellationen wird der Vorbehalt des Gesetzes durch die sog. Wesentlichkeitstheoriegeprägt[8]. Sie hat zur Folge, dass alle Fragen, welche für die Verwirklichung von Grundrechten wesentlich oder für Staat und Gesellschaft von Bedeutung sind, vom parlamentarischen Gesetzgeber geregelt werden müssen[9]. Die Wesentlichkeitstheorie kommt insbes. im Bereich der Leistungsverwaltung zur Anwendung, steuert aber auch im Bereich der Eingriffsverwaltung die Regelungsdichte (zu den Arten der Verwaltung Rn 20ff).
184
Der Gesetzesvorbehalt betrifft heute alle denkbaren Verhältnisse des Bürgers zum Staat. Traditionell trennte die Lehre das sog. allgemeine Gewaltverhältnis – das ist dasjenige Verhältnis, in dem jeder Bürger zum Staat steht – vom besonderen Gewaltverhältnis– das ist dasjenige Verhältnis, in dem spezielle Bürger zum Staat stehen (zB Beamte, Soldaten, Richter, Schüler, Studierende, Strafgefangene). Das Verhältnis dieser Bürger zum Staat ist durch eine besondere „Nähe“ zum Staat gekennzeichnet (dazu auch Rn 259f). Frühere Praxis war zB, das Schulverhältnis mit Hilfe von Verwaltungsvorschriften auszugestalten. Später vertrat ein Teil der Lehre die Ansicht, dieses besondere Gewaltverhältnis könne durch spezielle „Normen“, die sog. Sonderverordnungen, geregelt werden. Beide Lehren hat das BVerfG für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt und gefordert, auch die besonderen Gewaltverhältnisse müssten durch Gesetz geregelt werden[10]. Praktische Folge ist, dass das Schulwesen nunmehr weitgehend verrechtlicht ist. So finden sich etwa die Voraussetzungen für das „Sitzenbleiben“ in einem Parlamentsgesetz. Darüber hinaus müssen auch Vorgaben für die Haartracht von Soldaten in einem hinreichend bestimmten Gesetz geregelt sein[11].
Читать дальше