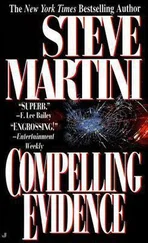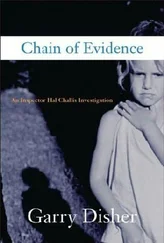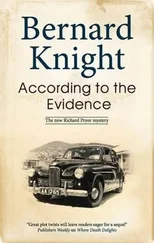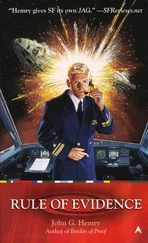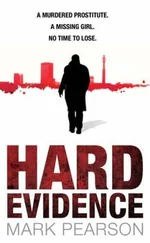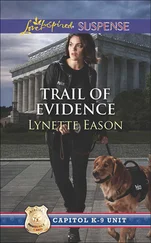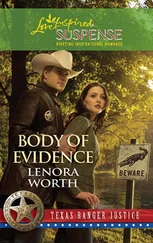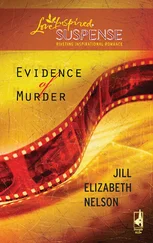1.4.1 Research Utilization
 Research Utilization als Prozess
Research Utilization als Prozess 
Seit den späten 1970er-Jahren wird in der pflegewissenschaftlichen Literatur das Konzept Research Utilization rezipiert (DiCenso et al. 2006, S. 5).
Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2000 dauert es durchschnittlich 17 Jahre, bis evidence-basierte Erkenntnisse in die klinische Praxis einmünden (Balas & Borgen 2000). Dieser Zeitraum kann als nicht zufriedenstellend bewertet werden. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Verpflichtung von Dienstleistungserbringer*innen im Gesundheitssystem, ihre Leistungen auf dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erbringen, offenbart sich hier eine Qualitätslücke. Demnach besteht ein Unterschied zwischen der aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse theoretisch möglichen und der tatsächlich erbrachten Gesundheitsleistung.
Überlegungen zu der Frage, wie valide Forschungsergebnisse in der Praxis von Praktiker*innen angewandt werden können, erfreuen sich in der Pflege seit über 35 Jahren zunehmenden Interesses. Das dabei zugrunde liegende Problem ist die bestehende Kluft zwischen Theorie und Praxis oder anders gesagt: zwischen dem Wissen und dem Handeln (Estabrooks 1999).
Forschungsanwendung wird einerseits im Sinne eines nötigen Handlungswissens (knowledge to action) und andererseits als Umsetzungshandeln (doing of it) verstanden (Graham 2006 in Haslinger-Baumann 2015). Die Forschungsanwendung kann direkt stattfinden, d. h. als Anwendung von Forschungsergebnissen z. B. aus Standards oder Guidelines in der klinischen Praxis. Sie kann auch indirekt erfolgen, indem die Kenntnis von Forschungsergebnissen das Denken oder Bewusstsein auch im Sinne einer »Erleuchtung« eher allgemein beeinflusst (Estabrooks 1999).
Der Begriff Research Utilization (Forschungsanwendung/Nutzung von Forschung) bezeichnet allgemein einen Prozess, bei dem theoretische, konzeptionelle oder auf Forschung basierende Erkenntnisse in jede Form von Praxis implementiert werden (Estabrooks 1999). Dieser Prozess des Synthetisierens, Verbreitens und Verwendens von forschungsgeneriertem Wissen schließt die Kommunikation über wissenschaftliche Ergebnisse und deren Anwendung ein. Forschungsanwendung zielt neben einer verbesserten Gesundheitsversorgung auf eine Veränderung bestehender Praxis.
Research Utilization wurde entwickelt, um die Probleme der mangelnden Nutzung von Forschungsergebnissen in der Praxis zu lösen. Sie ist ein mehrstufiger Prozess, der die Kritik und Synthese von Befunden aus mehreren Studien, die Anwendung dieser Befunde auf Veränderungen in der Pflegepraxis und die Messung der Ergebnisse aus der Veränderung der Pflegepraxis beinhaltet. Forschungsanwendung wird als ein Kontinuum beschrieben, das in drei Bereiche unterteilt werden kann:
• im ersten Bereich kommt es bei der betreffenden Pflegeperson zunächst durch einen Kontakt mit einer oder mehreren Forschungsarbeiten zu einer veränderten Haltung und einem veränderten Denken. Es führt noch nicht zwangsläufig zur Änderung der Pflegepraxis.
• im mittleren Bereich des Kontinuums kommt es zu einem Durchsickern bestimmter Ideen und Ergebnisse, die zu einer Änderung der individuellen Handlungsweisen und der Pflegepraxis führen können. Es ist ein schleichender Prozess der Veränderung, dem noch keine bewusste Entscheidung für eine Veränderung auf der Basis von Forschungsergebnissen zugrunde liegt.
• im dritten Kontinuum-Abschnitt kommt es nach Durchsicht und Würdigung von Forschungsarbeiten konkret zur Forschungsanwendung im engeren Sinne, d. h. zur gezielten Veränderung von pflegerischen Interventionen. Dies bezeichnet einen bewussten zielgerichteten Prozess mit einem klaren und beschreibbaren Ergebnis (Guegel 2004).
Als primäre Zielgruppe sieht das Konzept der Forschungsanwendung die pflegerisch Tätigen in den Handlungsfeldern vor. Aufgrund des Vorsprungs an Akademisierung in den angloamerikanischen Ländern werden selbstverständlich Pflegende auf der Bachelor- oder Masterebene als Anwender*innen des Konzepts fokussiert. Demgegenüber sind Produktion und Verbreitung von Forschungsergebnissen den Forschenden oder Pflegewissenschaftler*innen vorbehalten.
1.4.2 Research Utilization und EBN
 Research Utilization ist nicht EBN
Research Utilization ist nicht EBN 
In Publikationen wird der Begriff Research Utilization (RU) vielfach synonym mit evidence-basierter Praxis verwandt (Köpke et al. 2013; Estabrooks 1999). Jedoch ist bei synonymer Verwendung das EBN-Konzept zu reduziert abgebildet, denn es ist breiter oder auch weit umfassender als der eher allgemeine Prozess der Forschungsanwendung (DiCenso et al. 2006, S. 6). Verschiedene Autoren (z. B. Estabrooks 1999) verstehen die Forschungsanwendung als einen Teilaspekt von EBN. Oder andersherum, EBN umfasst die Forschungsanwendung und erweitert diese um den Einbezug der Perspektive der Empfänger*innen von Pflege und der klinischen Expertise der professionell Pflegenden (Guegel 2004, S. 250; DiCenso et al. 2006, S. 6).
Research Utilization kann ein komplexer, langwieriger und ungeordneter Prozess sein. Daher hat sich in den letzten Jahrzehnten die professionelle Praxisentwicklung von der Forschungsanwendung zur evidence-basierten Praxis unter Einbezug der Stärken von Forschungsanwendung entwickelt. Für die Pflege führte die Entwicklung von evidence-basierter Pflege über den Weg der Research Utilization.
Diese erfordert die Integration der besten Forschungsergebnisse von qualitativ hochwertigen Studien in einem gesundheitsbezogenen Bereich, wobei der Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und der Bewertung, Diagnose und Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen liegt. Darüber hinaus sind – entsprechend den vier Merkmalen des EBN-Konzeptes – klinisches Fachwissen und der Einbezug der Patient*innenbedürfnisse bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertiger und kosteneffizienter Gesundheitsversorgung wesentliche Komponenten für die bewusste Integration von Forschungsergebnissen in die Praxis. Evidence-basierte Pflege ist ein umfassendes Konzept, das spezifisch auch darauf zielt, die Patient*innensicherheit zu verbessern, die Kosten für das Gesundheitswesen zu senken und letztlich einen Rahmen zu schaffen, der die Entscheidungsfindung in patient*innenspezifischen Situationen unterstützt.
Im Vergleich der Konzepte zur Forschungsanwendung und evidence-basierter Pflege besteht ein Unterschied in der Einschätzung und Bedeutungszuweisung des wissenschaftlichen Beweises. EBN versteht sich als ein Handeln auf der Grundlage des besten verfügbaren wissenschaftlichen Beweises. Die Unterscheidung zwischen beiden Konzepten besteht in dem Vorhandensein von Kriterien, mittels deren die kritische Bewertung der wissenschaftlichen Ergebnisse erfolgt und die Einschätzung vorgenommen wird, was in der Konsequenz als bestes Ergebnis und damit wissenschaftlich bewiesen eingeordnet wird (Mayer 2004, S. 70 f.; Estabrooks 2009). Für das EBN-Konzept liegen Evidencehierarchien und damit Einstufungen für die Qualität der Forschung vor, die es in dieser Form für Research Utilization nicht gibt. Letztere verfügt zur Einschätzung von Forschungsarbeiten über die allgemeinen Gütekriterien und differenzierte Checklisten zur Prüfung der Qualität. Sie bezieht sich in der einfachsten Verwendung lediglich auf die Forschungsnachweise zur Handlungsbegründung (Mayer 2004, S. 71; Estabrooks 2009). Das Ergebnis ist dann ein Hinweis auf die wissenschaftliche Qualität einer Forschungsarbeit. Demgegenüber implizieren im EBN-Konzept die Kriterien zur Beurteilung der Evidence eine Hierarchie über die Beweiskraft von verschiedenen Studiendesigns. Weil die Aussagen zur Evidence auf ganz konkreten Vorstellungen zu methodischen Standards und auf einem bestimmten Typus von Forschung basieren, können die Begriffe »evidence-basiert« oder »wissenschaftsbasiert« und »auf Forschungsergebnissen aufbauend« nicht synonym genutzt werden (Wingenfeld 2004, S. 79).
Читать дальше
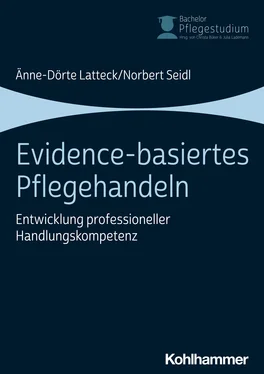
 Research Utilization als Prozess
Research Utilization als Prozess