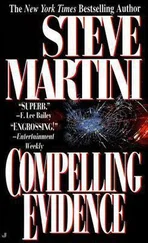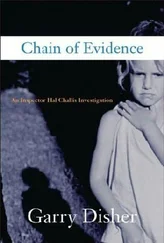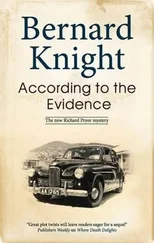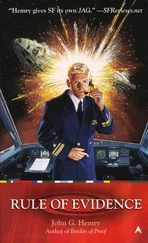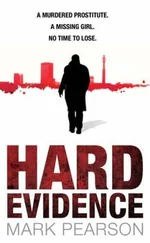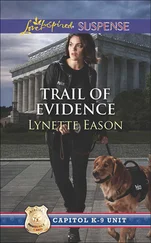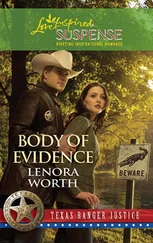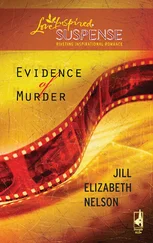Die Übersetzung von Evidence in Evidenz ist somit aus aktueller Perspektive eher ein missglückter Übersetzungsversuch.
1.2 Ziel des Konzepts Evidence-based Nursing
 Die Verbesserung der Patient*innenversorgung ist das Ziel.
Die Verbesserung der Patient*innenversorgung ist das Ziel. 
Das primäre Ziel von EBN besteht darin, den Pflegenden die derzeit besten wissenschaftlich belegten Handlungsoptionen aufzuzeigen und ihnen diese als Grundlage für die wirksamste Handlungsweise zur Verfügung zu stellen (Panfil & Wurster 2001, S. 33). Professionell Pflegende sind den Pflegebedürftigen verpflichtet, ihnen eine hochwertige Pflege auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis zukommen zu lassen.
Mit evidence-basierten Pflegemaßnahmen kann die Berufsgruppe der Pflegenden ihre Leistungen gegenüber den Kostenträgern legitimieren (Huckle 2008, S. 9).
 Patient*innenrechte und -erwartungen
Patient*innenrechte und -erwartungen 
Die Pflegebedürftigen haben ein Anrecht auf eine bestmögliche pflegerische Versorgung. Sie erwarten eine professionelle Versorgung und damit eine Pflege, die auch ihre Sicherheit berücksichtigt (Panfil 2012, S. 83). Zudem vertrauen sie auf eine Pflege mit Expertise (Meyer 2015, S. 13). Eine bestmögliche pflegerische Versorgung gelingt besser auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Einbezug der Werte und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen als beispielsweise ausschließlich auf der Grundlage von tradierten Handlungen, die mitunter mit der Aussage »Das haben wir immer schon so gemacht« begründet werden. Pflegerische Handlungen sind zwar traditionell mit lobenswerten Intentionen verbunden, jedoch haben sie nicht per se einen positiven Effekt, sondern können trotz guter Absicht negative Effekte verursachen (Schlömer 2000, S. 47). Vor diesem Hintergrund benennt Meyer (2015, S. 13) das Konzept EBN als alternativlos, wenn es darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse methodisch geordnet in Entscheidungen einzubeziehen und wesentliche von weniger aussagekräftigen wissenschaftlichen Beweisen zu trennen. Insbesondere aus ethischen Gründen ist es unzulässig, veraltete und wirkungslose Pflegehandlungen durchzuführen oder gar den Pflegeempfängern zu schaden (Panfil 2012, S. 83).
 effizienter Ressourceneinsatz
effizienter Ressourceneinsatz 
Ein weiteres Ziel von evidence-basierter Pflege besteht darin, dass die vorhandenen Ressourcen und Strukturen in den Handlungsfeldern von Pflege optimal im Sinne der Pflegeempfänger*innen genutzt werden (Huckle 2008, S. 9). So können die wirklich wirksamen Interventionen den Vorrang vor Pflegemaßnahmen mit unklarer Wirkung erhalten. Ebenso können beispielsweise wirkungslose oder schädigende pflegerische Interventionen begründet unterlassen werden. Insbesondere in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen sollten nur noch jene Maßnahmen durchgeführt werden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich gut belegt ist (Panfil 2012, S. 83).
Zusammengefasst soll EBN dazu beitragen, pflegerische Entscheidungen und Handlungen und in der Folge die klinische Versorgung von individuellen Pflegeempfänger*innen hinsichtlich einer positiven Beeinflussung von patient*innenrelevanten Ergebnissen zu verbessern.
1.3 Bedeutung evidence-basierten Pflegehandelns für ein professionelles Pflegehandeln
Sehr häufig ist von Pflegenden in der Praxis zu hören und auch in Publikationen zu lesen, dass professionelles Handeln durch pflegewissenschaftlich entwickelte Methoden, Konzepte und Instrumente gefördert werden kann. Dazu gehören beispielsweise die Anwendung des Pflegeprozesses, der Nationalen Expertenstandards oder auch der Einsatz verschiedener Assessmentinstrumente. Das folgende Kapitel geht der Frage nach, inwieweit das Konzept evidence-basierter Pflege professionelles Pflegehandeln befördern kann.
Das EBN-Konzept hat sich weltweit als zentrales Konzept für die Professionalisierung der Pflege entwickelt (DiCenso et al. 2006).
1.3.1 Beschreibung von professionellem Handeln
 Professionelles Handeln vereint systematische Wissensbestände und hermeneutisches Fallverstehen.
Professionelles Handeln vereint systematische Wissensbestände und hermeneutisches Fallverstehen. 
Unter Professionalisierung wird der Prozess der Verberuflichung von Tätigkeiten verstanden. Dies beinhaltet eine zunehmende Verwissenschaftlichung und Systematisierung von Wissen. Mit der hochschulischen Ausbildung von Pflegenden und der Entwicklung einer wissenschaftlichen Infrastruktur sowie veränderter gesetzlicher Vorgaben erweitern sich einerseits die Aufgabenbereiche von Pflegenden. Andererseits wurden Innovationen in Gang gesetzt (Friesacher 2009).
Es gibt verschiedene Professionstheorien und -verständnisse. Ältere professionstheoretische Ansätze betonen einzelne professionstypische Merkmale (z. B. das Vorhandensein eines Handlungsmonopols, einer Berufsethik, einer langen theoretischen Ausbildung), die bis hin zum Status einer Profession möglichst erfüllt sein müssen. Zugleich vernachlässigen sie den Aspekt des professionellen Handelns. Angemessener sind dagegen Professionskonzepte, die auf den Gegenstand, in der Pflege also auf die Pflegeempfänger*innen gerichtet sind (Friesacher 2009). In diesem Buch wird das professionelle Handeln als Bezugsgröße für die Professionalisierung zugrunde gelegt. Der professionssoziologische Ansatz von Oevermann mit einer interaktionistischen Position ist die Basis für die weiterführenden Überlegungen (Thiel et al. 2001, S. 270). Dieser Ansatz wurde 1995 von Weidner (2011) auf die Pflege übertragen.
Oevermann geht von zwei im Gegensatz zueinander stehenden Prinzipien aus. Zum einen gibt es die wissenschaftliche Kompetenz professionellen Handelns. Sie beinhaltet die systematischen Wissensbestände, das Verstehen von Theorien und Verfahren zu deren Konstruktion sowie die Theorieanwendung (Thiel et al. 2001, S. 270). Zum anderen gibt es die hermeneutische Kompetenz, die das Verstehen eines individuellen Falles/Pflegebedürftigen in dessen Sprache bezeichnet. Hier müssen die jeweiligen Pflegeempfänger*innen von den professionell Pflegenden in ihrer individuellen Erscheinungsform, ihrer Betroffenheit und in ihrer Biografie verstanden werden. Professionelles Handeln bezeichnet demnach ein durch wissenschaftliche Ausbildung erworbenes Spezialwissen und ein berufliches Erfahrungswissen zugleich. Beide Prinzipien sind in der Praxis einer professionellen Pflege untrennbar miteinander verbunden. Beide Prinzipien sind gleichermaßen konstituierend nötig, um professionelle pflegerische Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu begründen (ebd.). Dieser Logik folgend sind aufgrund der fallimmanenten Besonderheiten Pflegemaßnahmen nicht standardisierbar (ebd.).
 EBN kann theoretisch professionelles Handeln fördern
EBN kann theoretisch professionelles Handeln fördern 
Читать дальше
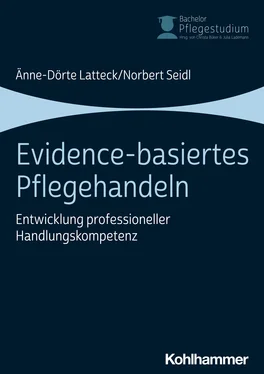
 Die Verbesserung der Patient*innenversorgung ist das Ziel.
Die Verbesserung der Patient*innenversorgung ist das Ziel.