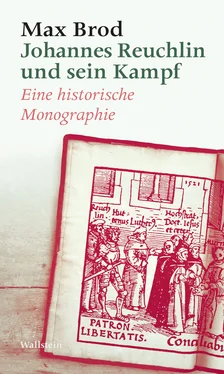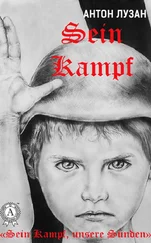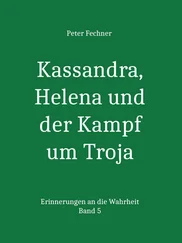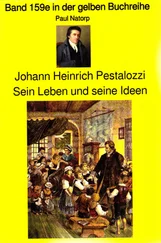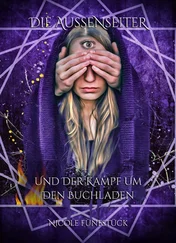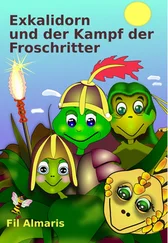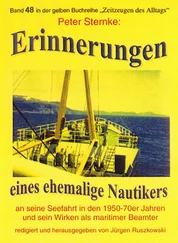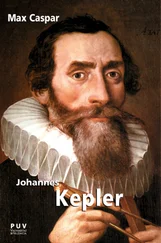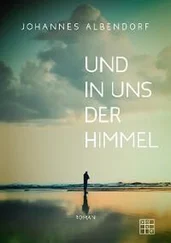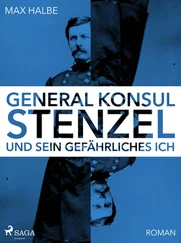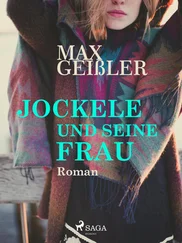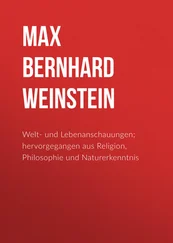Über den ersten Kreuzzug, der die Wendung zum Schlimmen brachte, lese man den nachfolgenden Bericht eines jüdischen Zeitgenossen, wie ihn Josef Kastein in seinem Buch ›Süßkind von Trimberg‹ übersetzt hat: »Er erspart uns jeden Kommentar«, wie Kastein richtig hinzusetzt. Die alte Quelle sagt:
»Und nun werde ich erzählen von dem Hinrollen des Verhängnisses auch in den anderen Gemeinden, die erschlagen wurden für Seinen Namen, den Einzigen, und wie sehr sie Gott, dem Gott ihrer Väter, anhafteten, und wie sie Seine Einzigkeit bewährten bis zum Auspressen ihrer Seele. – Es war im Jahre 4856 (1096), damals, als wir auf Befreiung und Trost hofften … da erhoben sich zuerst freche Gesichter, ein Volk fremder Sprache, ein bitteres, ungestümes Volk der Franzosen und Deutschen; sie richteten ihr Herz darauf, nach der heiligen Stadt zu gehen, welche verbrecherisches Volk entweiht hatte, um das Grab des Nazareners dort aufzusuchen, die Ismaeliter, die Bewohner des Landes von dort zu vertreiben und das Land in ihre Hand zu zwingen. Sie machten ein Zeichen, ein Mal, das nicht gilt, an ihre Kleider, ein Kreuz, jeder Mann und jede Frau, die ihr Herz trieb, den Irrweg zum Grab ihres Gesalbten zu gehen, bis daß sie zahlreicher waren als der Heuschreck auf dem Erdboden. Als sie durch die Städte zogen, wo Juden waren, sprachen sie einer zum anderen: Seht, wir gehen einen fernen Weg, um das Grab zu suchen, unsere Rache zu nehmen an den Ismaeliten, und seht, unter uns sitzen die Juden, deren Väter ihn grundlos erschlagen und gekreuzigt haben; rächen wir uns doch zuerst an ihnen, tilgen wir sie weg aus den Völkern, oder sie mögen werden wie wir und sich zum Nazarener bekennen. … Als die Gemeinden ihre Reden hörten, ergriffen sie das Handwerk unserer Väter: Umkehr, Gebet und Wohltun. Damals aber erschlafften die Hände des heiligen Volkes, ihr Herz schmolz, ihre Kraft ward schwach, sie verbargen sich in innersten Gemächern vor dem kreisenden Schwerte und quälten ihre Seele im Fasten. Sie ließen einen großen und bitteren Aufschrei hören. Doch ihr Vater antwortete ihnen nicht. Er hüllte sich in ein Gewölk, daß ihr Gebet nicht hindurchdrang. … Als die Söhne des heiligen Bundes sahen, daß das Verhängnis sich erfüllen würde, die Feinde sie besiegen und in den Hof eintreten würden, da weinten sie alle, Greise und Jünglinge, Jungfrauen und Kinder, Knechte und Mägde, zu ihrem Vater im Himmel weinten sie über sich und ihr Leben. Das Urteil des Himmels nahmen sie als gerecht auf sich und sprachen zueinander: Wir wollen stark sein. Für eine Stunde werden die Feinde uns töten, aber unsere Seelen werden leben und bestehen im Garten Eden. Und sie sprachen aus ganzem Herzen und williger Seele: Dies ist der letzte Sinn: nicht nachgrübeln über die Weise des Heiligen. Er hat uns seine Lehre gegeben und das Gebot, uns töten zu lassen für die Einzigkeit seines heiligen Namens. Wohl uns, wenn wir seinen Willen tun. Wohl dem, der umgebracht, der geschlachtet wird. Für die kommende Welt ist er bestimmt. Ihm wird getauscht eine Welt der Finsternis um eine Welt des Lichts, eine Welt der Not um eine Welt der Freude. … Da schrien sie alle mit lauter Stimme und sprachen wie ein Mann: Nun haben wir nicht mehr zu zögern, denn die Feinde kommen schon über uns her. Gehen wir rasch, tun wir’s, opfern wir uns vor dem Angesicht Gottes. Jeder, der ein Messer hat, prüfe es, daß es nicht schartig sei, und komme und schlachte uns für die Heiligung des Einzigen; und dann schlachte er sich selbst an seinem Halse oder steche sich das Messer in den Leib. … Als die Feinde vors Dorf gekommen waren, da stiegen einige von den Frommen auf den Turm und warfen sich in den Rhein, der am Dorfe vorbeifließt, und ertränkten sich im Strom und starben allesamt. … Als Sarit, die bräutliche Jungfrau, sah, daß sie sich mit den Schwertern umbrachten, daß sie geschlachtet wurden, einer vom anderen, da wollte sie vor dem Schrecken, den sie sah, durchs Fenster auf die Gasse entweichen. Aber als ihr Schwiegervater, Herr Jehuda, Sohn des Rabbi Abraham des Frommen, das sah, rief er ihr zu und sprach: ›Meine Tochter, weil ich nun nicht gewürdigt ward, dich meinem Sohne Abraham zur Frau zu geben, so sollst du doch nicht einem anderen, einem Fremden zur Frau werden.‹ Er führte sie vom Fenster weg, küßte ihren Mund, erhob mit dem Mädchen zugleich seine Stimme im Weinen und sprach zu allen, die umherstanden: Seht ihr alle, dies ist das Trauzelt meiner Tochter. Und sie weinten alle, ein großes Weinen. Sprach zu ihr Herr Jehuda: Komm, meine Tochter, lege dich hin in den Schoß Abrahams unseres Vaters, denn mit einer Stunde erwirbst du seine Welt. – Er nahm sie, legte sie in den Schoß seines Sohnes Abraham, zerhieb sie mit einem scharfen Schwert mittendurch in zwei Stücke; dann schlachtete er auch seinen Sohn. Darüber weine ich, und mein Herz jammert. Und nachher, als die Söhne des heiligen Bundes getötet dalagen, kamen die Unbeschnittenen über sie her, um sie auszuziehen und aus den Gemächern zu räumen. Sie warfen sie nackt durch die Fenster zu Boden, Berge über Berge, Haufen über Haufen. Und viele unter ihnen lebten noch, als man sie hinuntergestürzt hatte; ein wenig Leben war noch in ihnen, und sie winkten mit ihren Fingern: Gebt uns ein wenig Wasser zu trinken. Als die Verblendeten das sahen, daß in ihnen noch eine Spur Leben war, fragten sie: ›Wollt ihr euch taufen lassen? So werden wir euch Wasser zu trinken geben, und noch könnt ihr gerettet werden.‹ Sie aber schüttelten mit dem Kopfe, blickten hin zu ihrem Vater im Himmel, als sprächen sie: ›Nein!‹, und wiesen mit dem Finger nach oben. Doch kein Wort konnten sie aus ihrem Munde hervorbringen vor der Menge der Wunden, die ihnen zugefügt worden waren. Und jene fuhren fort, sie zu schlagen, über das Maß, bis sie sie zum zweiten Male umgebracht hatten.«
Kastein fügt hinzu: »Was hier mitgeteilt worden ist, illustriert die Vorgänge, die sich im Beginn des ersten Kreuzzuges (1096) in Speyer, Worms, Mainz, Köln und Trier abspielten. Es ist zu ergänzen, daß vielfach Juden bei diesen Angriffen zwangsgetauft wurden.«
Wie schwer das kirchlich Systematische auf dem gesamten Geistesleben des späteren Mittelalters lastete, beschreibt J. Huizinga in einer schier unerschöpflichen Beispielfolge in seinem ›Herbst des Mittelalters‹, nachdem er zuvor die Modemanieren des Ritterdienstes und sein »schönes, lügnerisches Spiel« eben als Spiel entlarvt hat, dessen hohe ethische Grundsätze selten ernstgenommen wurden – außer von seinem seltsamen Relikt, dem Ritter Don Quixote, dessen rührendes Befolgen der hohen Moral des Rittertums in seiner Tragikomik und wahnhaften Naivität doppelt ergreifend wirkt. – Auch im Frauendienst des Mittelalters spricht modische Sitte das erste Wort, wenngleich (meiner Ansicht nach) hier wohl viel mehr Erfahrung und echtes Gefühl mitbeteiligt war, als Huizinga annimmt. Daß aber auch die Frömmigkeit des angeblich so frommen Mittelalters nicht vor ›Gschnas‹ und Routine geschützt ist, das ist das Erstaunlichste, was man aus dem zitierten wichtigen Buch herausliest. Da heißt es etwa: »Das Leben der mittelalterlichen Christenheit ist in all seinen Beziehungen durchdrungen und völlig gesättigt von religiösen Vorstellungen. Es gibt kein Ding und keine Handlung, die nicht fortwährend in Beziehung zu Christus und dem Glauben gebracht werden. Alles ist auf eine religiöse Auffassung aller Dinge eingestellt. Wir sehen eine ungeheuerliche Entfaltung innigen Glaubens, aber in der übersättigten Atmosphäre kann die religiöse Spannung, die wirkliche Transzendenz, das Heraustreten aus dem Diesseits nicht stets gegenwärtig sein. Bleibt jene Spannung aus, dann erstarrt alles, was doch bestimmt war, das Gottbewußtsein zu wecken, zu einer erschreckenden Alltäglichkeit (von mir kursiv gesetzt), zu einer erstaunlichen Diesseitigkeit in jenseitigen Formen.« Es folgen Beispiele aus dem Leben eines so hochstehenden Frommen, wie Heinrich Seuse. Sie wirken bei aller Echtheit recht verspielt, manieriert. – Kein Wunder, daß solch eine Tyrannis des christlichen Lehrgebäudes auf viele (und darunter auf sehr ehrliche und hohe Geister) als unerträglicher Druck wirkte. »Es ist ein Prozeß fortwährender Herabsetzung des Unendlichen zu Endlichkeiten, ein Auseinanderfallen des Wunders in Atome. An jedes heiligste Mysterium heftet sich, wie eine Muschelkruste am Schiff, ein Gewächs äußerlicher Glaubenselemente an, die es entweihen.« – Man könnte von einer Verpöbelung der hochgespannten Stimmungen des Christentums sprechen. Zu solch abergläubischen Entartungen gehört vor allem der Reliquienkult, gegen den Reuchlin eine seiner beiden lateinischen Komödien (›Sergius vel Capitis caput‹) schreibt. – Man möchte es nicht für möglich halten, aber in einem durchaus nicht kirchenfeindlichen, objektiven, in keiner Weise überschwenglichen, eher trockenen Buch der Wissenschaft, in Willy Andreas’ hier schon angeführtem ›Deutschland vor der Reformation‹ liest man über Reliquienverehrung: »Das Wittenberger Heiligtum enthielt Ruß aus dem Feuerofen der drei Jünglinge. Im Schleswigschen Augustinerkloster Bordesholm zeigte man von der heiligen Jungfrau die gesamte Nähausrüstung einer Dame von Rang, auch etwas von ihrem Haargeflecht und sogar ein wenig Ohrenschmalz.«
Читать дальше