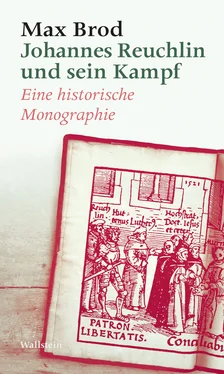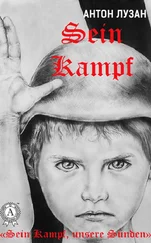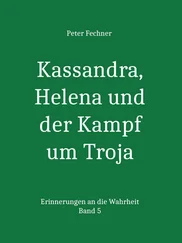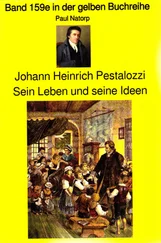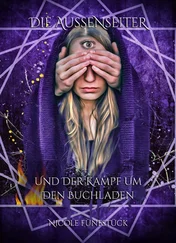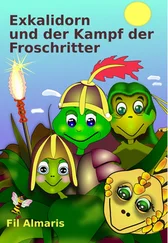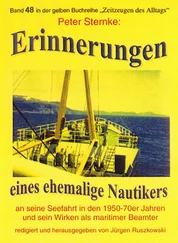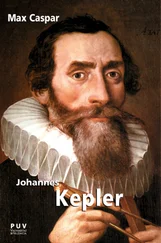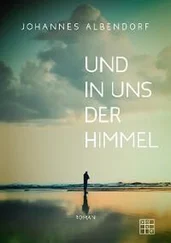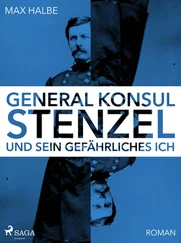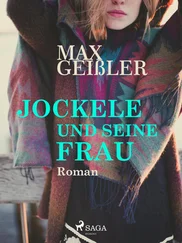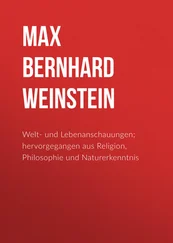4 Über Wunder. Naturphilosophie. Lob der hebräischen Sprache. – Heilige Namen. – Reuchlin über Unvollkommenheit der Übersetzung (Brief an den Abt von Ottobeuren). – Die Namen Gottes. – Einheit von Namen und Genanntem (Kratylos, Cusanus). – Volksglauben der Eskimos. – Seltsames über Erbsünde. – Capnion über die Gottesnamen. – Die Sfirót. – Das Tetragrammaton. – Der entfaltete Namen.
5 Reuchlins Orthodoxie. Er war kein Vorläufer Luthers. In wissenschaftlichen Fragen frei denkend, in religiösen überaus dogmatisch. – Linguistische Fehlgriffe. – Das wundertätige Wort wird aufgezeigt. Einschiebung eines 5. Buchstabens. – Hinweis auf Mörike, den mythenbildenden Dichter. Ekstatischer Abschluß des Buches. – Ein Druckfehler in der 4. Ausgabe des Buches.
FÜNFTES KAPITEL Humoristisches Zwischenspiel: Die beiden Komödien
1 Flucht Reuchlins nach Heidelberg 1496. – Diskussionen und Symposien. – Celtes, Dracontius, Wernher, Vigilius.
2 Vorläufer. – ›Sergius oder Das Haupt des Hauptes‹. – Sprachlicher Manierismus. – Kritik des chaotischen Stückes. – Satire gegen die Poetenfeinde. – Gegen den Reliquienmißbrauch. – Aufstieg des Stückes im 3. Akt. – Zerfahrener Schluß.
3 Die zweite Komödie (Progymnasmata, – ›Henno‹) wesentlich bedeutender. – Das Vorbild: Ma î tre Pathelin. – Bee und Blee, der originelle Grundeinfall. – Hinweis auf Goldoni und Nachwirkung bei Shakespeare (Petrucius?). – Dichterbegabung Reuchlins. Neuaufführungen des Henno 1955, 1964.
4 Elsula tritt auf. Dann Henno. Das Stück rollt ab. Ein dramaturgischer Vorschlag, Abra betreffend. – Die höchst gelungene Szene beim Astrologen. – Gericht und happy end. – Erfolg. Nachahmungen. Wiederentdeckung durch niemand andern als Gottsched. Etwas über die Fragwürdigkeit mancher Polemik.
SECHSTES KAPITEL Rechtslage und Zustand des jüdischen Volkes in Deutschland zur Zeit Reuchlins. – Missive und Rudimenta
1 Reuchlin auf der Höhe seines Ruhmes. Richter des schwäbischen Bundes 1502–1512. – Privatpraxis als Anwalt. – ›Literatorum monarcha‹.
2 Reuchlins Sorge um den befürchteten Untergang der hebräischen Sprache. – Habimah. – Anathi. – 2000 Jahre der Knechtschaft. – ›Aber fragt mich nur nicht: wie?‹ – Umrisse der jüdischen Existenz im Exil. – Die Römerzeit. – E. L. Ehrlich über Beschränkung der jüdischen Rechtsgleichheit (Konzil von Nicäa). – Die Schriften von Guido Kisch über den ganzen Komplex dieser Fragen. – Der besondere Rechtsschutz für die Juden und das Waffenverbot. – Sachsenspiegel. – Katastrophale Folgen. – Eine Glosse zum Sachsenspiegel 1325.
3 Das allmähliche Hinabgleiten der Juden auf der sozialen Skala (seit dem 1. Kreuzzug). – Die beiden Gründe hiefür: Haß seitens der Kirche, systematische Ausschließung aus den anständigen Berufen, Landwirtschaft und Handwerk. – Die Tragödie der Diaspora: Substanzverlust bis zum Selbsthaß. – Widerstand, autonome Wertskala. – Die Kammerknechtschaft der Juden, ursprünglich eine theologische (Augustinus u.a.), später eine politische Konzeption. – Gerade Kaiser Friedrich II., der geniale Hohenstaufe, der Verehrer der Kabbala, von Stefan George besungen, führt in Sachen der jüdischen ›Knechtschaft‹ den entscheidenden Schwertstreich 1236, 1237. – Entwicklung bis zu Kaiser Maximilian (Ranke). – Das odiose Privileg des Wuchers. – Generalprivilegium Friedrichs II. von Preußen.
4 Jossel von Rosheim versucht eine Sozialreform im jüdischen Sektor (Selma Stern). – Luthers fanatischer Antisemitismus. – Ablehnung seines monströsen Nazi-Programms durch heutige protestantische Autoritäten. (Analoge Bemühungen der Päpste Johannes XXIII. und Pauls VI., im Abschnitt 3.) – Reuchlin kein Judenfreund, doch ein redlich nach Gerechtigkeit strebender Mann, das Seltenste auf Erden.
5 Das deutsche Missive 1505. Ein flüchtiges Gelegenheitswerk. – Unterschied vom späteren, viel reiferen ›Augenspiegel‹. – Reuchlins mildes, vornehmes Wesen. – Die ›Rudimenta‹ hebräische Grammatik und Wörterbuch. – Reuchlins seltsame Stellung zur deutschen Sprache, später durch seinen kraftvollen Gebrauch des Deutschen korrigiert. – Pionierleistung eines worst-sellers. – Benützung hebräischer Quellen. – Stellt Raschi weit über Lyra. – Dennoch zwiespältiges Festhalten an Vorurteilen gegen die Juden.
SIEBENTES KAPITEL Der Streit mit den Kölnern beginnt
1 Der ›taufft Jud‹ Pfefferkorn. – Biographie eines widerlichen Menschen. – Zwei Arten von Konvertiten. Pfefferkorn gehört zu der aggressiven Sorte. – Sein Äußeres. Seine Streitschriften gegen das Judentum. – Ortwin Gratius.
2 Große Vergangenheit der Dominikaner. – Die Inquisition als Ursache des damaligen Verfalls? – Heutige Blüte dieses Ordens. – Hochstraten. Daten seines Lebens.
3 Kaiser Maximilians Mandat von Mantua 1509. – Charakteristik des Kaisers. – Sein Glanz, sein Schwanken. – Pfefferkorn besucht Reuchlin. – Pfefferkorn konfisziert in Frankfurt und anderwärts. – Mandat von Rovereto. – Rückstellung der beschlagnahmten Bücher (Mandat 1510). – Das vierte Mandat wählt einen langen Weg. – Indifferenz der Juden gegenüber dem ganzen weiteren Streit. Zwei Ausnahmen. – Reuchlins ›Ratschlag‹ gegen das Pfefferkornsche Anliegen. – Die Gutachten der Universitäten. – Mutian und sein Kreis.
4 Der Kaiser macht einen ›Schieber‹. – Pfefferkorn veröffentlicht unlegal den geheimen ›Ratschlag‹ Reuchlins. – Stilistisches Talent Pfefferkorns, ›Handspiegel‹.
ACHTES KAPITEL Der Augenspiegel
1 Reuchlins Antwort auf den ›Handspiegel‹ 1511. – Einteilung des ›Augenspiegels‹.
2 Reuchlins Pathos. – Sieben Gruppen der hebräischen Literatur. – Der Talmud. – Reuchlin gibt seine mangelhafte Kenntnis des Talmud zu. – Einige Irrtümer Reuchlins. – Fehlerhafte Verteidigung einer Gebetstelle. Ismar Elbogens Standardwerk über den ›Jüdischen Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung‹. – Der getretene Wurm krümmt sich. – Pfefferkorns dumme Verleumdung der Redensart ›Seid wilkum‹. Reuchlins Abwehr. – ›Die Heimlichkeit mancher Kunst‹. – Die weiteren 4 Gruppen der hebräischen Literatur werden verteidigt. – Reuchlins Toleranz. – Seine Sophismen. – Scholastische Disputation, 52 Argumente. – 34 Unwahrheiten Pfefferkorns. – Die Juden sitzen mit den Christen ›in einem Bürgerrecht und Burgfrieden‹. – Nächstenliebe, auch den Juden geschuldet. – Verwahrt sich empört gegen die Verleumdung Pfefferkorns, der ihm Bestochensein vorwirft.
NEUNTES KAPITEL Weiterer Kampf. Bis zum päpstlichen Endurteil 1520
1 Pfefferkorn predigt in Frankfurt gegen Reuchlin. – Der Frankfurter Stadtpfarrer Peter Meyer berichtet an die theologische Fakultät in Köln. – Arnold von Tungern. – Warnungsbrief Udalrics. – Reuchlin fühlt sich krank und schwach. – Submisser Brief an Tungern. – Weltmacht der dominikanischen Inquisition.
2 Reuchlin an Konrad Collin und an die Fakultät. – Parallel-Korrespondenz. – Barocke Konvention des Briefstils.
3 Unverhüllte Ansprüche der Kölner: Widerruf des Augenspiegels verlangt. – Reuchlins feste Haltung. – Abbruch der Korrespondenz. – Pfefferkorns ›Brandspiegel‹.
4 Der Kaiser gegen den Augenspiegel. – Reuchlins ›Defensio‹ 1513. – (Geigers ›Masochismus der Objektivität‹). – Audienz bei Kaiser Maximilian. – Die Kölner mobilisieren vier Universitäten. – Dann auch die Universität Paris. – Paris gegen Reuchlin. – Die deutschen Humanisten und einige deutsche Fürsten nehmen Reuchlins Partei. – Erasmus, Mutian, Pirckheimer. – Gefahr für Reuchlin: die hohen Kosten des Prozesses. – Ketzermeister Hochstraten lädt ihn vor sein Gericht in Mainz. – ›Dies irae‹ in Mainz. Niederlage Hochstratens. – Appellation an den Papst. – Das Urteil von Speyer 1514, Sieg Reuchlins (sein einziger Sieg in dem langdauernden Verfahren). – Die Kölner appellieren an Papst Leo X. – Das Gericht wird in Rom konstituiert. – Empfehlungen und Helfer. Unter ihnen groteskerweise auch Maximilian. Trotz des päpstlichen Schweigeverbots: umfangreiche Literatur auf beiden Seiten. – Die Dunkelmännerbriefe. – Rom vertagt die Entscheidung 1516. – Die Mitarbeiter der Dunkelmännerbriefe. – Analysen von David Friedrich Strauß und Walter Brecht. – Crotus Rubeanus und der Erfurter Kreis. – Einige Proben aus den Briefen. Der Magister Conradus aus Zwickau u. a. – Keine Äußerung Reuchlins über die Briefe. – Erasmus fällt um. – Nachahmungen. – Päpstliches Breve gegen die Briefe 1517. – Triumphus Capnionis (Hutten). – Pfefferkorns ›Beschyrmung‹. – Reuchlins Arbeiten: 1517 Kabbala, 1518 De accentibus. – Illustrium virorum epistolae. – Die beiden Apologien Hochstratens 1518, 1519. – Der Graf von Nuenar. – Erasmus an Hochstraten. – Pfefferkorns letzte Schmähschrift. – Hochstraten ovans. – Das Eingreifen Sickingens, er droht den Dominikanern mit der Fehde 1519. – Urteil des Papstes gegen Reuchlin 1520. – Das Ereignis wird von den Wirren um Luther in den Hintergrund gedrängt. – Ein ironischer Schnörkel der Weltgeschichte: Leo X. regt die Drucklegung des ganzen babylonischen Talmud durch die Bombergsche Offizin in Venedig an. – Der wesentliche Unterschied der humanistischen und der reformatorischen Bestrebungen wird in Rom zu Reuchlins Schaden übersehen.
Читать дальше